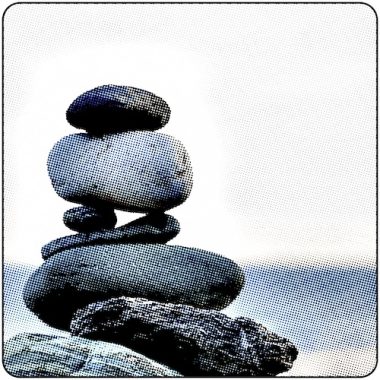Ausgabe #111 | 17. Februar 2022
Gott würfelt nicht
Beteiligung wird ja im Allgemeinen als dialogischer Prozess verstanden – mal mit mehr, mal mit weniger Wirkungsanspruch. Und tatsächlich haben Dialoge das Potential, Themen nicht nur besonders unterhaltsam, sondern auch besonders tiefgehend durchdringen zu können.
Das erkannte schon der griechische Philosoph Platon, der fast alle seine Werke in Dialogform abfasste. Und auch der Titel unserer heutigen Ausgabe entstammt einem Dialog: der historisch einzigartigen Debatte über Gott, Glauben und die Physik, die Albert Einstein und Niels Bohr öffentlich und privat führten.
Obgleich beide sehr unterschiedliche Positionen hatten (und beibehielten) blieben Bohr und Einstein einander zeitlebens in gegenseitiger Hochachtung verbunden. Allein aus diesem Grunde könnten wir von den beiden großen Denkern schon einiges lernen.
Einstein glaubte nicht. Nicht an Gott. Und auch nicht wirklich an den Zufall. Das Thema für die Physik zu vertiefen, würde uns tief in die Sphären der Quantenmechanik führen. Zu tief.
Also bleiben wir bei den Dingen, die uns in diesem Newsletter interessieren: die Rolle des Zufalls in der Beteiligung. Konkret: in der Auswahl der zu Beteiligenden.
Gute Beteiligung ist immer Betroffenenbeteiligung. Denn genau darum geht es: Betroffene nicht allein zum Spielball politischer Prozesse zu machen, in denen Ergebnisse vielfältigen Einflüssen unterliegen und genau die Interessen der unmittelbar Betroffenen allzu oft die geringste Rolle spielen.
Gute Beteiligung basiert deshalb auf einem soliden Scoping, also der Ermittlung eben der Gruppen und Akteur*innen, die betroffen sind oder sein könnten. Das ist mühsam, aber unvermeidbar.
Die Alternative dazu lautet Selbstrekrutierung: Wer immer will, der darf…
Diese Methode sorgt jedoch in verlässlicher Regelmäßigkeit dafür, dass bestimmte Gruppen überrepräsentiert sind und den Prozess dominieren. Andere Gruppen nehmen nicht oder kaum teil. Weil sie sich das nicht zutrauen, dem Prozess nicht vertrauen oder weil sie schlicht nicht davon erfahren haben.
Nun gibt es aber Prozesse, bei denen es so viele (potentiell) Betroffene gibt, dass nicht alle beteiligt werden können – zum Beispiel bei Beteiligungsangeboten auf Bundes- oder Landesebene. Und es gibt Themen, bei denen nicht wirklich klar ist, wer alles betroffen sein könnte (zum Beispiel bei Zukunftsplanungen).
Genau hier kommt der Zufall ins Spiel. Bei den zunehmend beliebten Bürgerräten ist das u. a. der Fall. Die Medien sprechen hier gerne von „Zufallsbürgern“. Ein unglücklicher Begriff. Menschen sind kein Zufall. Und ihre Auswahl ist es auch nicht.
Um noch einmal Einstein zu bemühen: Gott würfelt nicht. Und auch kein/e Anbieter*in eines Bürgerrates.
Tatsächlich werden Bürgerräte nicht zufällig besetzt – und auch kein einziges anderes Beteiligungsformat in unserer Republik. Und das gleich aus mehreren Gründen.
Denn anders als bspw. bei der Benennung der Schöffen in unserem Rechtssystem kann kein/e Bürger*in dazu gezwungen werden, sich zu beteiligen. Wer als Schöffe berufen wird, kommt aus der Nummer nur mit wirklich guten Gründen wieder raus. Wer für ein Beteiligungsformat ausgelost wird, kann einfach „nö“ sagen. Und tut dies auch. In der Praxis gehen wir gegenwärtig davon aus, dass deutlich über 90 % der so benannten Bürger*innen diese Einladung ablehnen.
Das ist am Ende dann kein Zufall mehr, sondern eher eine „unverbindliche Einladung zur Selbstrekrutierung“.
Ich hatte versprochen, dass wir uns diese Rekrutierungsmethode (und Alternativen dazu) einmal anschauen.
Vier unterschiedliche Konzepte habe ich heute im Angebot. Alle vier werden in der Praxis genutzt. Alle haben ihre Vorteile. Und ihre Nachteile.
Und alle sind gut. Manche sind besser für bestimmte Anlässe.
- Wir haben den eben schon erwähnten Klassiker, manche nennen es die „reine Zufallsauswahl“: eine Ziehung der Beteiligten aus dem Telefonbuch oder dem Melderegister. Die Gezogenen werden eingeladen, ein winziger Teil davon nimmt die Einladung an. Für ein Format mit 50 Beteiligten wird man in der Regel rund 1.000 Menschen einladen müssen. Die Nachteile: hoher Aufwand, hohe Kosten und am Ende ziemlich sicher ein Panel, das alles andere als repräsentativ ist. Die soziale Zusammensetzung wird eher einem typischen repräsentativen Gremium ähneln als dem Bevölkerungsquerschnitt. Diese Methode, wir nennen sie „Zufallsauswahl mit Selbstrekrutierung (ZS)“ hat also ihre Grenzen.
- Die zweite beliebte Methode ist das genaue zeitliche Gegenteil: Erst werden öffentlich Bürger*innen eingeladen, sich zu „bewerben“ – und aus den Bewerber*innen wird dann das endgültige Panel ausgelost. Wir haben hier also zunächst die Selbstrekrutierung und danach die Zufallsauswahl (SZ). Die Methode ist manchmal weniger aufwändig, erzeugt eine höhere Sichtbarkeit, bereitet also den eigentlichen Prozess schon kommunikativ vor. Das ist smart, am Ende aber wird man mit demselben Problem konfrontiert wie bei der ZS-Methode.
- Beide Methoden haben das Problem der mangelnden Repräsentativität insbesondere der so genannten „Stillen Gruppen“. Jene Gruppen, die eigentlich bewusst überrepräsentiert sein sollten, um deren Wirksamkeit im Prozess zu ermöglichen. Das versucht die sogenannte Gewichtung zu lösen. Zum Beispiel, indem zunächst zufällig aus dem Melderegister gelost wird – allerdings nach sozidemografischen und/oder projektrelevanten Quoten. Wir haben also erst die Gewichtung, dann die Zufallsauswahl, aber am Ende immer noch die Selbstrekrutierung (GZS). Das ist schon besser, wenn eine gewisse Breite angestrebt wird. Natürlich ist das am Ende weder wirklich zufällig noch repräsentativ – nur näher dran. Ein Nachteil dieser Methode: In manchen Kommunen spielen die Datenschutzbeauftragten nicht mit.
- Das umgeht die vierte Methode, die zunächst zu Bewerbungen einlädt, die Bewerber*innen um soziodemografische Daten bittet und danach quotiert auslost. Diese SGZ-Methode kommt der Repräsentativität besonders nah, auf Kosten des Zufalls und einer oft mühsamen Akquise-Kampagne. Die aber bemüht sich zwangsweise gerade auch um Gruppen, die nicht leicht zu gewinnen sind. Sie ist deshalb besonders anspruchsvoll, zeit- und ressourcenintensiv, aber tatsächlich dann zu empfehlen, wenn die Breite der Beteiligten besonderes erstrebenswert ist.
Funktionieren können alle vier Methoden (und alle eröffnen noch einige Variationen und Nuancen, für die uns hier der Raum fehlt. Da wäre auch noch die GZSGZ-Methode, eine „Königsvariante“, die Sie sich nun fast selbst zusammenreimen können).
Wir sehen: Der Zufall spielt immer mit, aber rein zufällig ist nichts. Gott würfelt nicht. Die Beteiliger auch nicht. Und wenn sie es tun, dann sind die Würfel präpariert. Aus gutem Grund.