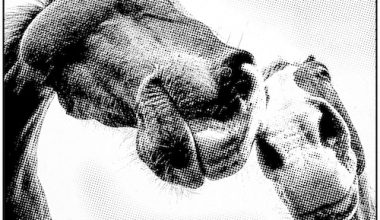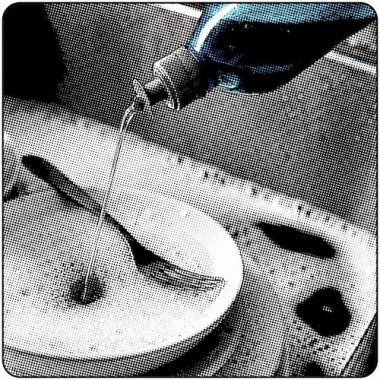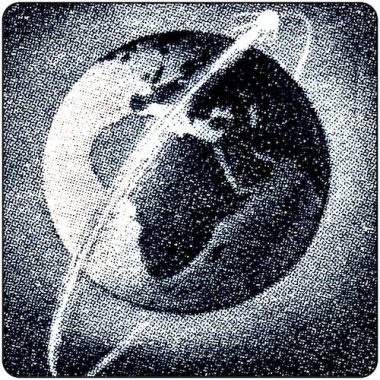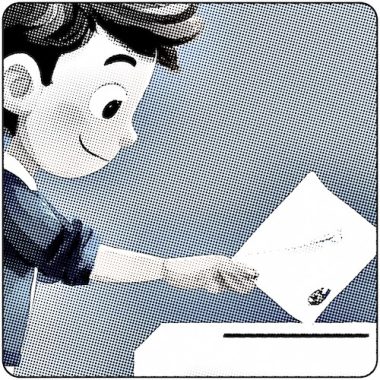Ausgabe #214 | 8. Februar 2024
Die Bermuda-Konferenz
Während in Europa und anderswo der zweite Weltkrieg tobte, reisten diese Herren ins tropische Bermuda.

Das Foto der Reisenden zeigt sie in bester Stimmung. Doch die Herren aus Großbritannien und den USA waren nicht unter Palmen zusammengekommen, um Urlaub zu machen.
Sie hatten ein Thema, das kaum weiter weg von guter Laune entfernt sein konnte: Es ging um die Rettung der Juden vor dem Holocaust.
Im April 1943 war die systematische Vernichtung der Juden nicht mehr zu leugnen. Polen sei zum »wichtigsten Schlachthof der Nazis geworden«, die dortigen Gettos würden »von allen Juden geleert«, hatten die USA und Großbritannien schon vier Monate zuvor in einer gemeinsamen Erklärung festgestellt.
Es ging also um das Schicksal von Millionen Menschen. Entsprechend sensibel waren die Verhandlungen. Und Bermuda ließ sich wunderbar isolieren – vor allem vor der Presse.
Von Anfang an stand der Prozess unter keinem guten Stern. Während die Amerikaner mit Top-Politikern anreisten, schickten die Briten nur untergeordnete Beamte.
Gleichzeitig waren die Erwartungen hoch. Der World Jewish Congress hatte detaillierte Rettungspläne entworfen und den Delegierten vorgelegt.
Gleichzeitig hatte man Sorge, die Erzählung der Nazis von einer „Verschwörung des internationalen Judentums“ zu bedienen.
In den USA standen Präsidentschaftswahlen an und Roosevelt hatte Sorge, die Deutschen würden einer massenhaften Ausreise von Juden in die USA zustimmen – was seine Wiederwahl gefährden könnte.
Starke rechtsradikale Narrative, Migrationsphantasien, ängstliche Politiker. Auch 80 Jahre später kommt einem manches bekannt vor.
Auf Bermuda sorgten sie damals dafür, dass der Prozess ins Trudeln kam. Erwartungen, Vorgaben, Denkverbote und Teilnehmerkreis passten nicht zusammen.
Am Ende kam, was kommen musste: Die Konferenz scheiterte.
Doch selbst das wollte man nicht eingestehen. Also wurde Aktivismus simuliert. Es wurden 13 unverbindliche „Empfehlungen“ formuliert, die sich allesamt auf den Umgang mit Flüchtlingen in neutralen Staaten bezog.
Der Holocaust ging weiter. Sogar der britische Verhandlungsführer Richard Law nannte die Konferenz später in einem Brief an seinen Außenminister eine „Fassade für Untätigkeit“.
Scheitern ist in der Politik verpönt. In Demokratien gehört es aber dazu. Immer wieder. Gerade der demokratische Sieg einer Idee, Partei, Interessengruppe bedeutet oft: das Scheitern der anderen.
Deshalb können auch demokratische Prozesse scheitern. Nicht immer liegt das an Unvermögen oder Unwillen Einzelner.
Manchmal stimmen schlicht die Rahmenbedingungen nicht. Manchmal sind die Erwartungen zu hoch, die Informationen zu difffus, die Formate zu schlecht, die Ängste zu groß.
Manchmal ist die Zeit zu kurz, die Moderation überfordert, die Öffentlichkeit zu gespalten. Und manchmal sind es schlicht die falschen Menschen, die den Prozess gestalten sollen.
In der Regel sind die Folgen gescheiterter demokratischer Prozesse nicht so fatal wie 1943 auf Bermuda. Aber manchmal eben doch. Demokratie ist ein Handlungsrahmen für gemeinwohlorientierte Ergebnisse. Aber keine Garantie.
Vor diesem Hintergrund wäre es vermessen, ausgerechnet an Prozesse demokratischer Teilhabe strengere Kriterien anzulegen. Wenn Prozesse von und mit Profis immer wieder scheitern, warum billigen wir das nicht auch in der demokratischen Teilhabe zu?
Gute Bürgerbeteiligung zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie Lai*innen beteiligt. Ja, in der Regel werden diese Prozesse von Profis organisiert. Häufig genug aber von Quereinsteiger*innen und Menschen mit solider Verwaltungsausbildung.
Und doch gibt es immer wieder Beteiligungsprozesse, die abgebrochen, gar als „gescheitert“ wahrgenommen werden. Irritierend ist es, dass dann oft genug ausgerechnet Politprofis mit dem Finger auf den Prozess zeigen, gerne auf die Verwaltung, oder jene Politiker*innen, die die Beteiligung ermöglicht haben, manchmal sogar auf die Beteiligten selbst.
Beteiligungsprozesse können scheitern. Und das ist gut so. Weil zu Ergebnisoffenheit eben auch gehört: kein Ergebnis.
Natürlich ist das im Moment frustrierend für alle Beteiligten. Und ein Fressen für jene, die Beteiligung ohnehin kritisch sehen.
Kritisch darauf zu schauen, ist auch durchaus angebracht. Denn eine abgebrochene Beteiligung ist immer ein Zeichen. Dafür, dass etwas nicht gestimmt hat.
War es zu wenig Zeit, Geld, Geduld, Information? War es das falsche Thema oder Format? Der falsche Zeitpunkt? Eine unglückliche Moderation? Oder wurden schlicht die falschen Akteur*innen beteiligt? Waren bestimmte Interessen zu dominant? Andere gar nicht vertreten?
Es kann viele Gründe dafür geben, einen Prozess ergebnislos abzubrechen. Doch das muss kein Scheitern sein. Tatsächlich ist es die Chance zu einem Fortschritt: Wenn es gelingt, daraus für einen weiteren, besseren Prozess zu lernen.
Denn für Bürgerbeteiligung als demokratischen Prozess gilt das gleiche, wie für die Demokratie insgesamt:
Man hat nie fertig.