Ausgabe #105 | 6. Januar 2022
Die Nichtbetroffenen
Zunächst waren es nur einige weitere Scherben und Fragmente. Der amerikanische Archäologe Sterling Dow und andere Forscher*innen, die in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Athen arbeiteten, konnten sie zunächst nicht deuten.
Die Fundstücke enthielten Rillen und Schlitze, in Linien und Spalten angeordnet. Es dauerte einige Zeit, bis Dow und andere hinter das Geheimnis kamen: Sie hatten Teile eines Kleroterion gefunden – einer komplexen antiken Losmaschine.
Genutzt wurde sie aber nicht für die Ermittlung von Lottozahlen oder eine altgriechische Bingo-Variante. Ausgelost wurden damit Bürger (im alten Griechenland bekanntermaßen keine Bürgerinnen). Und das in der Hochzeit der attischen Demokratie um 400 v. Chr. für zahlreiche Funktionen. Ob Ratsmitglieder oder Richter: Das Los entschied, wer das Amt (oft nur für einen Tag) innehatte.
Und das waren nicht wenige. Allein große Prozesse hatten sagenhafte 2001 Richter. Der „Rat der 500“ spielte eine zentrale Rolle und wurde nur einmal jährlich ausgelost. Er bereitete alle Gesetzesvorschläge vor, die der Volksversammlung zur Diskussion unterbreitet wurden. Außerdem verhandelte er die Abkommen mit ausländischen Mächten. 50 Ratsherren bildeten – erneut nach Losentscheid – für je ein Zehntel des Jahres die Regierung (Prytanen). Täglich bestimmte das Los einen Prytanen zum Vorstand oder Präsidenten. Er besaß einen Tag lang den Schlüssel der Schatzkammer.
Bis heute wissen wir tatsächlich nicht ganz exakt, wie ein Kleroterion funktionierte. Und auch über die Motive für den so massiven Einsatz von Losverfahren gibt es keine endgültige Klarheit.
Anders als zum Beispiel bei der losbasierten Jurybesetzung in den USA schien es überwiegend nicht um eine Zwangsrekrutierung der Ausgelosten gegangen zu sein. Offenbar musste man sich zum Beispiel für ein Richteramt aktiv dem Losverfahren stellen.
Alten Schriften entnehmen wir immer wieder, dass es vor allem eine grassierende Angst vor Korruption und Vetternwirtschaft gab.
Mittels Losauswahl, verbunden mit einer angesichts einer vergleichsweise geringen Bevölkerungszahl hohen Zahl von Mandatsträgern, stellte man vor allem aber sicher, dass Konflikte (in Justiz und Politik) überwiegend von Menschen bearbeitet wurden, die nicht unmittelbar betroffen waren. Das ist klug, denn das nimmt Emotionen und Ängste.
Es ermöglicht auch unkonventionelle Ansätze und kreative Lösungsvorschläge. Wir kennen das alle: Wenn sich im Freundeskreis oder in der Familie zwei streiten, liegt für alle Unbeteiligten meist schnell eine Lösung auf der Hand. Überlässt man die Lösungsfindung den Streithähnen jedoch selbst, ist die Eskalation vorprogrammiert.
Im Grunde ist das ja auch die Idee der repräsentativen Demokratie und unseres Berufsrichterwesens: Entschärfung von Konflikten, indem Dritte Lösungen suchen.
Das hat ohne Zweifel seine Vorteile. Wir sollten uns nur bewusst sein: Es ist das Gegenteil von Beteiligung. Im Idealfall entscheiden Unbeteiligte, Nichtbetroffene – bei uns sogar hauptberuflich Nichtbetroffene.
Das funktioniert, wie immer, in der Praxis nur begrenzt. In unserer Politik kommen zu den gerade mal +/- 700 hauptberuflichen Bundestagsabgeordneten die mehr als zehnfache Anzahl hauptberuflich Betroffener: Lobbyist*innen. Dazu Parteiräson und persönliche Karriereinteressen. Kein Wunder also, dass aktuell die Idee der losbasierten „Bürgerräte“ so viele Freunde findet.
Mit dem Charme der altgriechischen Urdemokratie versehen, werden sie als neues Format der Bürgerbeteiligung gesehen, das korrigierend eingreifen und unsere Demokratie beleben kann. Die Erwartungen an das Format sind hoch. Und die Kriterien sind anspruchsvoll. Besonders großer Wert wird auf die Repräsentativität gelegt. Die Anteile der Frauen, der Altersgruppen, der Bildungsgrade sollen in etwa denen der Bevölkerung entsprechen, alle Regionen sollen berücksichtigt werden.
Bei regelmäßig zwischen 30 und 120 Mitgliedern bedarf das mehrerer korrigierender Durchgänge. Am Ende ist es kein Losverfahren, sondern eine „zufallsbasierte Auswahl“. Nur so ist das Ziel erreichbar.
Das ist natürlich etwas anderes, als das muntere morgendliche Losen auf dem Versammlungsplatz des alten Athen. Und deshalb führt uns der Vergleich, ohne den kaum ein Medienbericht zu Bürgerräten auskommt, auch rasch in die Irre.
Bei unseren modernen Versuchen mit Bürgerräten (denn noch experimentieren wir) geht es um Repräsentativität und um die Formulierung von Vorschlägen an die Politik, die nach wie vor allein entscheidet.
Im alten Athen ging es um die Vermeidung von Entscheidungsbeeinflussung durch Betroffenheit und Korruption. Die Auslosung mittels Kleroterion sollte keine Repräsentativität herstellen, nicht für die Bürger, schon gar nicht für die Gesamtbevölkerung, die ja überwiegend aus Menschen ohne Beteiligungsrechte (Sklaven, Frauen, Junge, Migranten) bestand.
Zufall ist nicht repräsentativ. Es ist nicht die Aufgabe von Zufallsverfahren Repräsentativität herzustellen. Repräsentativität und Zufall sind zwei verschiedene Konzepte. Und beide haben eher wenig mit Beteiligung zu tun. Denn die klassische Aufgabe von Bürgerbeteiligung ist Betroffenenbeteiligung.
Es geht hier nicht darum, verbindliche Entscheidungen herbeizuführen (dafür haben wir repräsentative Strukturen), sondern Betroffene an diesem Prozess zu beteiligen, Lösungen im Diskurs zu suchen und um Gemeinwohl gemeinsam zu ringen. Gerade dann, wenn persönliche Betroffenheit vorliegt. Das ist Beteiligung. Und deshalb findet sie Tag für Tag in vielen Kommunen statt.
Bürgerräte auf Bundesebene sind dazu keine Alternative. Sie sind etwas völlig anderes: ein Modell partizipativer Politikberatung, eine Chance auf die Erdung von politischen Entscheider*innen, ein Beitrag zur Generierung kreativer Lösungen. Das macht sie wertvoll.
Aber nicht zu einer Alternative für die breite Beteiligung Betroffener. Letztere ist es, die breite Selbstwirksamkeitserfahrung für viele bietet und die ganz entscheidend für die Stärkung unserer Demokratie ist. Dies von den wenigen bundesweiten Bürgerräten mit den wenigen beteiligten Bürger*innen zu erwarten, wäre vermessen.
Und nicht fair.



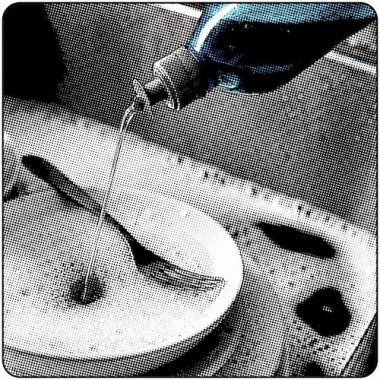
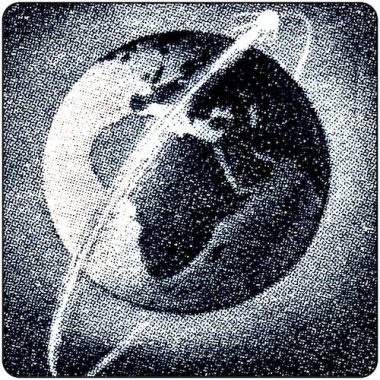


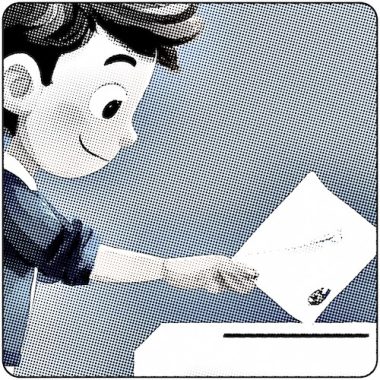

Sehr geehrter Herr Sommer,
vielen Dank für Ihren neuen Newsletter. Besonders schön ist der historische Exkurs!
Erlauben Sie mir bitte jedoch, den Thesen aus diesem Newsletter Nr. 106 massiv zu widersprechen.
Sie schreiben, dass Bürgerräte nicht repräsentativ seien. Und dass es mehr Beteiligung der Betroffenen geben müsse.
Jedenfalls aus Sicht von Baden-Württemberg treffen diese Thesen nicht zu. Im Einzelnen:
1. Wir betonen immer und immer wieder, dass Bürgerräte nicht repräsentativ sind. Meiner Erfahrung nach gilt das auch für Praxis in ganz Deutschland. Deshalb ist es nicht korrekt, davon zu sprechen, Befürworter von Bürgerräten sprächen von Repräsentativität. Wichtig ist es, die Auswahlkriterien transparent zu machen. Hier sei exemplarisch auf das Beteiligungsportal von Baden-Württemberg verwiesen.
2. Das glatte Gegenteil ist richtig. Die Zufallsauswahl erfolgt, wie Sie selbst schreiben, mit verschiedenen Lostöpfen. Einfachstes Beispiel: Je 50% Frauen und Männer. Ziel der losbasierten Auswahl ist gerade nicht die Repräsentativität, sondern die Vielfalt. Also junge und alte Menschen, solche aus Städten und vom Land usw. Vielfalt ist etwas ganz anderes als Repräsentativität. Sie zeigt sich auch darin, dass in der Input-Phase immer auch die Randpositionen, die harten Projektgegner und Initiativen der Zivilgesellschaft einzubinden sind.
3. In Baden-Württemberg sind diese Grundsätze der Zufallsauswahl sogar gesetzlich geregelt. Seit 04.02.2021 gilt das Gesetz über die Dialogische Bürgerbeteiligung. Damit sind auch die Datenschutzfragen geklärt.
4. Das deutsche Rechtssystem zielt fast ausschließlich auf die Betroffenen-Beteiligung (Ausnahme z.B. das Verbandsklagerecht der Umweltverbände) oder auf die Behauptung, man sei betroffen. Die Dialogische Bürgerbeteiligung dagegen hat gerade das Ziel, diese Überbetonung auszugleichen. Es gibt keinen nennenswerten Mangel bei der Betroffenenbeteiligung. Die Betroffenenbeteiligung erfasst zudem niemals die politische Dimension des Streits!
Alles Gute für 2022 und weiter viele Newsletter.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Arndt
Stuttgart
Lieber Herr Arndt,
vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und die Darstellung Ihrer Ansätze und Sichtweisen in der baden-württembergischen Landesregierung.
Fast alles kann ich teilen oder zumindest nachvollziehen, an einer stelle gibt es wohl ein Missverständnis, an einer anderen sicher eine unterschiedliche Wahrnehmung.
Die (tatsächliche oder vermeintliche) Repräsentativität spielte tatsächlich in der Begleitkommunikation der ersten Bürgerräte eine sehr große Rolle, ich habe den ersten Bürgerrat ja im Beirat begleitet und die Unterlagen hier vorliegen. Die Zusammensetzung wurde in den Berichten dazu sehr ausführlich diskutiert und Repräsentativität reklamiert. Sie spielte – möglicherweise auch dadurch beeinflusst – dann in der Medienrezeption eine große Rolle. Wir haben in unserem Institut sämtliche Berichte dazu analysiert. die Frage der Repräsentativität spielt darin eine erhebliche Rolle – überwiegend wurde sie (übrigens nicht ganz zu recht) als ergeben angesehen und als Pro-Argument verbucht. Soweit zu dem möglichen Missverständnis. Wenn Sie die Einschätzung haben, dass Repräsentativität für Bürgerräte nicht wirklich relevant ist, dann teile ich dies, wie ich ja auch in dem obigen Text schrieb. Da es sich um eine Form partizipativer Politikberatung handelt, ist bereits gem. Habermas ausreichend, möglichst viele Sichtweisen dabei zu haben, auf die quantitative Repräsentativität kommt es weniger an – wenn die Formate dies entsprechend berücksichtigen (Also z.B. auf Abstimmungen verzichten).
Eine unterschiedliche Meinung haben wir bezüglich des Umfangs under der Qualität der Betroffenenbeteiligung in Deutschland. Sie schreiben. „Es gibt keinen nennenswerten Mangel bei der Betroffenenbeteiligung“. Das überrascht mich nun doch – und steht im Widerspruch zu so gut wie allen Branchenexperten, mit denen ich in den diversen Netzwerken spreche. Aber: Sie haben mein Erkenntnisinteresse geweckt. Mich (und sicher auch andere Leser*innen) würde sehr interessieren, wie Sie diese Einschätzung begründen.
Herzlichst, Ihr Jörg Sommer