Ausgabe #215 | 5. Februar 2024
Schwarz blüht der Enzian
Die Band hat es in sich. Frontmann Heino grölt im schwarzen Lederoutfit. Stefan Mross demoliert seine Gitarre auf der Bühne. Patrick Lindner rockt am Bass und Gotthilf Fischer malträtiert das Schlagzeug. Die Wildecker Herzbuben geben die Security.
Im Metal-Sound präsentieren sie Volkslieder wie die „Haselnuss“, „Hoch auf dem gelben Wagen“ oder „La Paloma“.
Gibt’s nicht? Gibt’s doch.
Crossover nennt die Fachwelt es, wenn zwei gänzlich unterschiedliche Musikrichtungen gemischt werden. Das geht oft in die Hose. Manchmal aber auch direkt in die Charts.
Bei Heino hat es geklappt, auch wenn der Mann nicht nur musikalisch, sondern auch politisch umstritten ist.
Tatsächlich hat die Geschichte des Crossover viel mit politischer Korrektheit zu tun. Und mit politischer Inkorrektheit. Oder schlicht: mit Rassismus.
Denn die Crossover-Geschichte hat ihre Wurzeln in den 40er Jahren in den USA. Damals führte das tonangebende Billboard-Magazin getrennte Hitlisten ein. Es gab schwarze Rhythm-and-Blues- sowie weiße Country- und Pop-Charts. Die Genres waren klar getrennt.
Das änderte sich nur langsam. Erst coverten weiße Musiker wie Pat Boone und andere schwarze Songs als weiße Pop-Versionen, dann folgten umgekehrt Adaptionen weißer Songs durch schwarze Musiker und ab Mitte der 50er Jahre flossen die getrennten Linien immer weiter zusammen.
Bis heute wird der Begriff Crossover gerne dann verwendet, wenn Interpret*innen in Genres unterwegs sind, die man ihnen eigentlich nicht zugetraut hätte. Werden zwei Genres in einem Song verschmolzen, sprechen die Expert*innen auch gerne von „Fusion“.
In der demokratischen Teilhabe kennen wir tatsächlich auch beides, wenn auch noch recht selten.
Gerade mit dem Aufkommen des relativ neuen Formats der Bürgerräte wächst die Kreativität der Beteiligungsgestalter*innen.
Denn die Stärke der Bürgerräte ist zugleich auch ihre Schwäche.
Ihre losbasierte Zusammensetzung führt dazu, dass bei vielen Teilnehmenden eine weniger bis gar nicht vorhandene unmittelbare Betroffenheit vorliegt. Das macht sachliche Debatten leichter. Es bietet aber keine Beteiligungsangebote für jene, die sich betroffen fühlen, aber eben nicht ausgelost wurden.
Dazu sind sie aufwändig und bewirken demokratische Lernprozesse meist nur bei den wenigen unmittelbar Beteiligten. Die ZEIT schrieb deshalb kürzlich von der „aufwändigsten Politik-Volkshochschule des Landes“.
Um diese Schwäche auszugleichen, experimentieren überall im Land Akteur*innen mit Crossover- und Fusionselementen.
Im süddeutschen Bischweier ging es um eine Industrieansiedelung. Dort folgte auf einen Bürgerrat (mit 34 Teilnehmenden) eine offene Bürgerveranstaltung und dann ein direktdemokratischer Bürgerentscheid.
Im brandenburgischen Werder konnten sich die Jugendlichen nicht nur direkt mit Ideen am Zukunftshaushalt beteiligen. Im Anschluss durften sie auch über die Vergabe von beachtlichen 200.000 Euro abstimmen. Ein gelostes Gremium aus Kindern und Jugendlichen bereitete diese Wahl vor.
Aber auch auf Bundesebene gibt es Möglichkeiten: Die Bertelsmann Stiftung hat aktuell mit dem Forum gegen Fakes ein großes Bürgerbeteiligungsprojekt zum Umgang mit Desinformation gestartet. Dabei wird ein offen zugängliches Online-Forum mit einem losbasiert besetzten Bürgerrat mit 120 Mitgliedern verknüpft. Die Online-Vorschläge sollen vom Bürgerrat zu Handlungsempfehlungen weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse werden im kommenden Herbst an Akteur*innen der Zivilgesellschaft und der Politik übergeben.
In allen drei Beispielen werden losbasierte Formate mit anderen Elementen kombiniert. Egal, ob Bürgerhaushalt, Online-Forum oder sogar direktdemokratische Entscheidungen: Die Integration diverser Formate in einen Prozess macht die Beteiligung breiter, intensiver, ertragreicher.
Das gilt nicht immer, aber oft. Und es müssen auch keine losbasierten Elemente enthalten sein. Die Kombination unterschiedlicher Formate für unterschiedliche Gruppen, die Verknüpfung niedrigschwelliger spontaner Angebote mit intensiven Formaten, von Online- und Offline-Beteiligung, von budgetorientierter Abstimmung mit inhaltlicher Deliberation kann perfekt funktionieren.
Viele der Möglichkeiten wurden bislang kaum praktisch erprobt, viele durchlaufen gerade irgendwo in Deutschland ihren ersten Praxis-Check. Wir lernen immer noch dazu.
Dieses Lernen heißt natürlich manchmal auch: aus Fehlern lernen.
Eine besondere Herausforderung kombinierter Formate hat sich bereits herausgeschält. Manchmal stellen sich die Kombinationen nur aus Sicht der Beteiligenden als ein durchgehender Prozess dar.
Aus Sicht der Bürger*innen liest es sich dann eher wie eine willkürliche und wenig stringente Teilhabe – mit kaum erkennbarem Wirkungsanspruch.
Doch das muss nicht sein.
Wie man kluge Strings aus diversen Formaten bildet, die den Wirkungsanspruch von dialogischer Beteiligung lebendig und erkennbar werden lassen, das schauen wir uns in der kommenden Woche etwas genauer an.




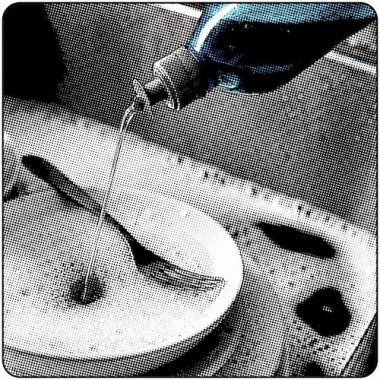
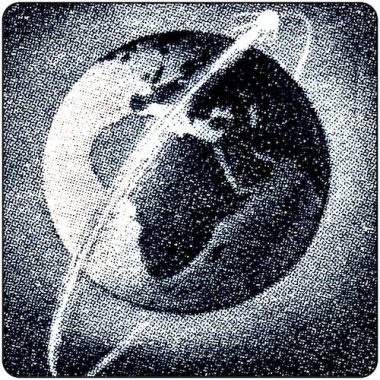


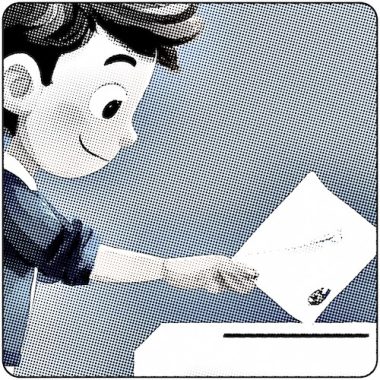
Früher hat man das auch Triangulation genannt, später auch Crossmedialisierung. Crossover ist auch ein schöner Begriff. Auf jeden Fall ist die Idee, Öffentlichkeitsbeteiligung prozessual zu denken und geschlossene, halböffentliche und öffentliche Formate miteinander zu kombinieren und in einer sinnvollen Abfolge miteinander zuverknüpfen, mit jeweils unterschiedlichen Arbeits- bzw. Beteiligungsaufträgen und unterschiedlich zusammengesetzten Teilnehmenden kein neues Genre.
Lieber Oliver Märker,
ja, die Begrifflichkeiten. Triangulation war eine etwas unglückliche Anlehnung an die empirische Sozialforschung, fokussiert auf unterschiedliche Sichtweisen unterschiedlicher Akteure auf dieselbe Herausforderung. Das kann man in verschiedenen Prozessen machen, muss man aber nicht. Ich gehe im kommenden Newsletter ja noch darauf ein. Crossmedialisierung hat die Idee verschiedener (eigentlich Kommunikations- und nicht Beteiligungs-)Kanäle im Blick. Die Idee, Formate zu kombinieren ist tatsächlich fast so alt wie die Bürgerbeteiligung. Durch die Pandemie gab es einen Boom bei der Kombination analoger und digitaler Verfahren. Vorher war das eher im Fokus einiger innovativer Dienstleister, plötzlich wollten (und konnten) es alle. Und durch den aktuellen Hype in Sachen Bürgerräte ist die Kombination von los- und betroffenheitsbasierten Formaten gerade im Trend. Viel Neues, viel Altes und die immer relevante Frage: Wie wird daraus EIN Prozess? Und muss es das überhaupt?