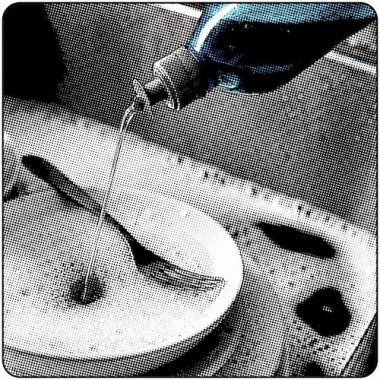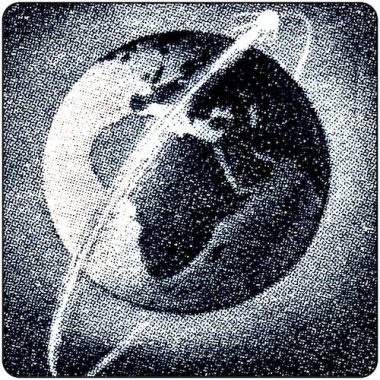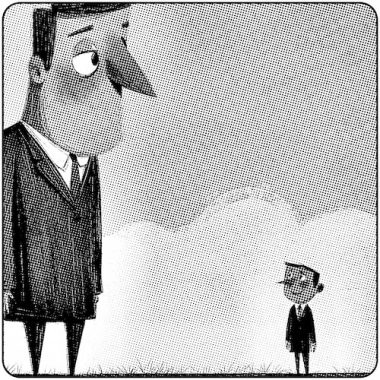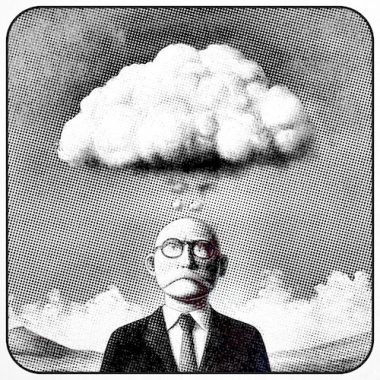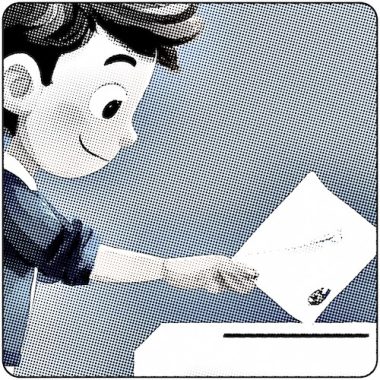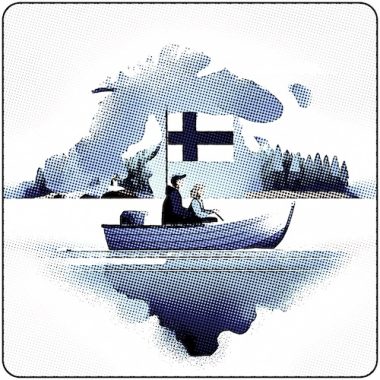Ausgabe #269 | 27. Februar 2025
Guter Rat für Räte
Unser zukünftiger Bundeskanzler verfügt über eine Menge politischer Erfahrung.
Politische Gegner weisen zwar immer wieder darauf hin, dass er noch auf keiner Ebene Regierungserfahrung vorzuweisen hat.
Doch das täuscht.
Friedrich Merz wurde bereits vor 35 Jahren erstmals Abgeordneter im EU-Parlament, war dann lange im Bundestag und dort auch Fraktionsvorsitzender. Zudem arbeitete er lange als Lobbyist für diverse große Konzerne.
Das kann man kritisch sehen. Aber ihm politische Unerfahrenheit vorzuwerfen, zieht nicht. Das Gegenteil ist richtig: Friedrich Merz verfügt über so umfangreiche politische, wirtschaftliche und strategische Kompetenzen, dass sie ihm noch eine weitere Karriere beschert haben:
Als Mitglied in Aufsichtsräten, Beiräten und Verwaltungsräten in der Wirtschaft.
Diese Gremien sind oft von großer strategischer Bedeutung und demnach auch weit mehr als nur formale Pflichtgremien. Sie beraten, sie entscheiden oft über die wesentlichen Ausrichtungen. Deshalb wird über ihre Zusammensetzung viel nachgedacht.
Es gibt Headhunting-Agenturen, die sich auf das Finden und Gewinnen von Mitgliedern solcher Gremien spezialisiert haben, es gibt einen eigenen Fachverband, sogar eine Zeitschrift mit dem Titel „Der Aufsichtsrat“.
Friedrich Merz war ein besonders geschätztes Mitglied. Nicht nur in einem, sondern in mehr als einem Dutzend Gremien. Zu den Firmen, die er so begleitete gehören u.a. AXA Konzern, Commerzbank, BASF, Deutsche Börse, DBV-Winterthur Holding, HSBC Bank und BlackRock Deutschland.
Unser nächster Bundeskanzler war ein überdurchschnittlich aktives Aufsichtsratsmitglied. Doch es gibt Hunderte, ja Tausende Menschen, die in mehreren Aufsichtsräten sitzen.
Die zeitlichen Anforderungen sind dabei unterschiedlich. Viele Aufsichtsräte haben gerade mal zwei Sitzungen im Jahr. In Krisen oder bei Unternehmensübernahmen können es deutlich mehr sein.
Die Tätigkeit ist so wichtig, dass sie sehr gut honoriert wird.
Die Aufsichtsräte der größten börsennotierten Konzerne haben 2022 rund 117 Millionen Euro erhalten – so viel wie noch nie. Und ihre Vergütung soll weiter steigen.
Bei der Deutschen Börse (siehe oben) erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates jährlich 110.000,- Euro, für jeden Unterausschuss kommen nochmal 35.000,- Euro hinzu. Der Vorsitzende erhält sogar 300.000,- Euro pro Jahr. Nehmen sie auch wirklich an Sitzungen teil, gibt es noch einmal 1.000,- Euro Sitzungsgeld oben drauf.
Wertschätzung und Nutzen definieren sich in der Wirtschaft nun einmal über Geld. Und diese Summen zeigen uns: Aufsichtsräte sind wichtig.
Weil sie regelmäßig einen Blick von außen in die Unternehmensentwicklung einfließen lassen. Weil sie sich nicht im Apparat verfangen, weil sie kritisch und manchmal auch unbequem sind. Weil sie Impulse einbringen. Oft auch, weil sie die Kunden des Unternehmens gut kennen, ihre Erwartungen und Bedürfnisse.
So wie andere Gremien in unserer Gesellschaft.
Ich denke da an eine konkrete Form von Beirat: Auch hier geht es um einen Blick von außen. Von Menschen, die nicht im Apparat verfangen, kritisch und manchmal auch unbequem sind. Weil sie Impulse einbringen. Menschen, die die „Kunden“ kennen, ihre Erwartungen und ihre Bedürfnisse.
Diese Beiräte begleiten keine Konzerne, sondern Kommunen.
Es sind die Beteiligungsbeiräte.
Nicht jede Kommune hat einen. Die meisten sind jünger als 10 Jahre. Sie heißen sehr unterschiedlich:
Beteiligungsbeirat, Arbeitskreis Bürgerbeteiligung, Beteiligungsrat,
Bürgerforum, Koordinierungsgruppe, Beirat Bürgerbeteiligung, Städtisches Netzwerk Bürgerbeteiligung, Lenkungsgruppe, Koordinationskreis Beteiligung oder Bürgerrat …
Sie sind auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt.
Vertreter aus Verwaltung und Kommunalpolitik sind oft dabei. Meist auch organisierte Zivilgesellschaft. Häufig stattdessen oder ergänzend geloste unorganisierte Bürger, seltener Vertreter der lokalen Wirtschaft, manchmal auch unabhängiger Beteiligungsexperten und/oder Wissenschaftler.
Ihre Arbeitsgrundlagen sind ebenfalls divers. Mal sind sie in Leitlinien begründet, anderswo durch eine Satzung oder Verwaltungsvorschrift. Seltener gab es einen einfachen Einsetzungsbeschluss des Kommunalparlaments und gar nicht wenige Beiräte sind einfach informell etabliert worden.
Die Welt der Beteiligungsbeiräte ist also vor allem bunt.
Und doch gibt es zwei Gemeinsamkeiten zwischen nahezu allen dieser Gremien:
Es gibt keine Vergütungen, nicht einmal Sitzungsgeld. In nahezu keinem Fall.
Und: Es gibt Frustrationen. In sehr vielen Fällen.
Im Rahmen der Evaluationen kommunaler Beteiligungskultur, die das Berlin Institut für Partizipation seit Jahren durchführt, berichteten in über 90% der dabei untersuchten Beteiligungsbeiräte, Mitglieder von Frustrationserlebnissen.
Mangelnde Vergütung war dabei so gut wie nie ein Thema, immer wieder tauchten aber vergleichbare Muster auf.
Beiratsmitglieder aus der Einwohnerschaft haben Schwierigkeiten mit den oft sehr formellen Sitzungen und den langsamen Fortschritten. Akteure aus Verwaltung und Politik bleiben nach den ersten Monaten oft fern, weil sie zeitlich stark beansprucht sind und kaum Mehrwert in den Terminen erkennen.
Besonders häufig treten Frustrationen dort auf, wo Beiräte trialogisch mit Politik, Verwaltung und gelosten Bürger*innen besetzt sind und zugleich einen langen Katalog an Aufgaben haben.
Das führt zu Erwartungen an das Gremium, die weder aus Sicht der Verwaltung, noch der Kommunalpolitik – und auch nicht der Einwohnerschaft – eingelöst werden können.
Aus diesem Grund steigt die Zahl der „ehemaligen“ Beiräte, die optimistisch gestartet sind, aber zwischenzeitlich wieder eingestellt wurden.
Andere Kommunen denken über grundlegende Reformen nach oder haben sie bereits durchgeführt.
Zusammenfassend lässt sich aus 10 Jahren Beteiligungsbeiratspraxis in Deutschland sagen:
Das eine, perfekte Beiratsmodell gibt es nicht.
Aber es gibt zwei Erfolgsfaktoren.
Zunächst einmal lohnt es sich, das Aufgabenspektrum eines Beteiligungsbeirates nicht zu breit zu fassen und es so klar wie möglich zu konkretisieren.
Ist das erfolgt, muss die passende Besetzung gefunden werden. Eine trialogische Struktur mit Politik, Verwaltung und organisierter Zivilgesellschaft macht vor allem Sinn, wenn konkrete Beteiligungsvorhaben vorab diskutiert werden sollen. Aber auch die Weiterentwicklung von Leitlinien und die Evaluation von Beteiligungsprozessen können in dieser Zusammensetzung erfolgreich angegangen werden. Wobei ein Beirat, der evaluiert durchaus auch externe Expert*innen integrieren könnte.
Soll ein Beteiligungsbeirat eher „die Stimme der Bevölkerung“ oder selbst ein Beteiligungsformat sein, dann braucht es losbasiert eingeladene Bürger*innen – und nur diese.
Das Berlin Institut für Partizipation hat als Arbeitshilfe eine Matrix entwickelt, die Aufgaben und entsprechende Idealbesetzungen übersichtlich darstellt. Sie kann hier heruntergeladen werden.
Die darin enthaltenen Empfehlungen sind genau das: Empfehlungen. Keine Vorgaben. Aber sie basieren auf der Evaluation zahlreicher Beteiligungsbeiräte.
Natürlich können andere Zusammensetzungen und diverse Aufgabenkombinationen funktionieren.
Aber nicht automatisch. Und nicht von alleine.
Egal, welche Variante am Ende gewählt wird: Es lohnt sich, Aufgaben, Ausstattung und Zusammensetzung genau zu durchdenken.
Doch das gilt eigentlich für alle Beteiligungsprozesse. Immer.
Auch wenn Sie dann – fast immer – anders laufen, als geplant.
Das ist dann längst nicht immer ein Fehler, manchmal auch ein Zeichen von Qualität. Doch das ist schon wieder ein anderes Thema …