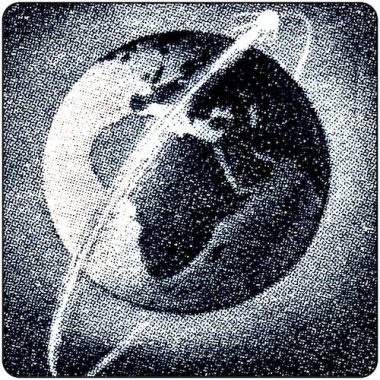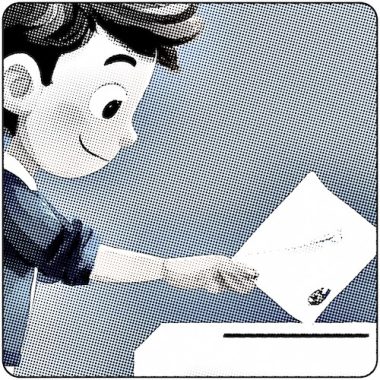Ausgabe #54 | 14. Januar 2021
Demokratie als Spiel
Kleine Kinder lernen nicht. Sie spielen. Und das ist weit mehr als bloße Beschäftigung. Das Spielen hat im Leben von Kindern weder etwas mit zufälliger Freizeitgestaltung noch mit einer rein lustbetonten Tätigkeit zu tun. Es ist kein Nebenprodukt einer Entwicklung. Und es ist unverzichtbar.
Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf eines Kindes. Spielerisch übt es sich darin, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten Sinn des Wortes zu begreifen.
Mit dem Alter des Kindes steigt die Komplexität des Spieles. Es wird sozialer, andere Kinder werden einbezogen. Regeln werden nötig, ausgedacht, diskutiert, verändert, verworfen, auch einmal ignoriert – und durchgesetzt. Dieser Umgang mit Regeln ist für unser ganzes Leben prägend, denn gesellschaftliches Miteinander ist regelbasiert.
Und das gilt auch für demokratische Teilhabe.
Nicht ohne Grund heißt einer der zehn Grundsätze Guter Beteiligung, wie sie die Allianz Vielfältige Demokratie formuliert hat: „Gute Bürgerbeteiligung erfordert die gemeinsame Verständigung auf die Verfahrensregeln“ (Allianz Vielfältige Demokratie, 2017).
Im Bereich der Beteiligung ergeben sich die Regeln meist aus den politischen Rahmenbedingungen (Was steht überhaupt zur Disposition?) sowie aus der Wahl der Methodik. Darüber sprachen wir ja ausführlich in der vergangenen Woche.
Wir erinnern uns: Die Wahl der Methode gibt automatisch Regeln vor. Je ausgefeilter die Methodik, desto komplexer und „enger“ ist das Regelwerk. Sind Methodik und damit Regeln zu Beginn gesetzt und nicht verhandelbar, dann wird die Sache problematisch. Warum?
Werfen wir dazu einen Blick auf die Spieltheorie.
Ihre Wurzeln liegen weniger in der frühkindlichen Pädagogik, sondern in der Mathematik. Begründet wurde sie in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts u. a. von dem ungarischen Mathematiker John von Neumann, der wie so viele seiner Generation vor den Nazis in die USA flüchtete. Dort war er einer der Entwickler der Atombombe. Ähnlich universal denkend wie sein Freund Albert Einstein entwickelte er wichtige Impulse in ganz unterschiedlichen Feldern der Physik, Mathematik, Informatik, Ökonomie und in den Gesellschaftswissenschaften.
Die moderne Spieltheorie modelliert Entscheidungssituationen, in denen mehrere Beteiligte miteinander interagieren. Sie versucht dabei unter anderem, das Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen zu verstehen.
Betrachten wir einen typischen Beteiligungsprozess einmal spieltheoretisch, wird die entscheidende Rolle der Regeln rasch in seiner elementaren Bedeutung erkennbar.
Natürlich kann ein „Spiel“ nur dann funktionieren, wenn alle Beteiligten die Regeln nicht nur kennen, sondern sich auch daran halten.
Die Rahmensetzung, das Thema und der Wirkungshorizont werden dabei von der beteiligenden Institution vorgegeben. Sie definiert Umfang, Dauer, Ressourcen, oft auch Formate und einzelne Prozessschritte. Dies geschieht manchmal unter Beteiligung von Expert*innen und Dienstleister*innen. Manchmal werden sogar fertige, standardisierte „Formate“ eingekauft.
Werden dann noch die Beteiligten vollständig „rekrutiert“, ist die Gefahr groß, dass der ganze Prozess in Schieflage gerät, insbesondere dann, wenn es um die Akzeptanz von Vorhaben und Planungen geht, bei denen das „ob“ im Grunde gar nicht mehr zur Disposition steht – und das ist nicht selten der Fall.
Übersetzen wir ein solches Beispiel einmal in die Spieltheorie. Dies würde in etwa folgender Konstruktion entsprechen: Ein Spieler entwickelt die Spielidee, schreibt sämtliche Regeln, entscheidet über die Ressourcenverteilung und lädt dann andere Spieler*innen zur Teilnahme ein. Voraussetzung ist jedoch, dass sie seine Regeln und die Tatsache akzeptieren, dass es für sie persönlich im Grunde gar nichts zu gewinnen gibt. Niemand würde wohl erwarten, hier tatsächlich gutwillige Mitspieler*innen zu finden.
Warum sollte das dann bei der Bürgerbeteiligung anders sein?
Natürlich kann dieses Vorgehen funktionieren, insbesondere dann, wenn es nicht um Konfliktthemen geht, sondern um eher grundlegende Diskurse, die die Teilnehmenden nicht in Kategorien von „Sieg“ oder „Niederlage“ denken lässt.
Dies ist übrigens eine der Stärken von Beteiligung mit Zufallsrekrutierung – solche Verfahren verzeihen in der Regel deutlich mehr methodische Schwächen als Betroffenenbeteiligung. Aus diesem Grund arbeiten beteiligende Institutionen und mancher Dienstleister so gerne mit rekrutierten Teilnehmer*innen.
Dennoch gilt grundsätzlich für alle Formen politischer Teilhabe, völlig unabhängig von Thema, Konfliktpotential oder Zusammensetzung der Beteiligten:
Regeln für eine soziale Interaktion auf Augenhöhe – und nichts anderes ist bei demokratischer Teilhabe anzustreben – sollten grundsätzlich einvernehmlich von allen Beteiligten getragen werden.
Deshalb empfehle ich seit langer Zeit in allen Beteiligungsprozessen unabhängig von Größe, Dauer und Umfang, an den Anfang einen formellen „Beteiligungsvertrag“ zu setzen. In ihm sind grob die wichtigsten gemeinsamen Spielregeln fixiert. Dazu gehört u. a.
- wie der Prozess abläuft,
- aus welchen Bausteinen er besteht und welche Methode(n) eingesetzt wird/werden,
- welche Rechte und Pflichten die Beteiligten haben,
- wie ggf. Anpassungen des Verfahrens an neue Herausforderungen oder Erkenntnisse vorgenommen werden können,
- welche Phasen des Beteiligungsprozesses öffentlich und welche intern sind,wie die Ergebnisse dokumentiert und bekanntgegeben werden,
- wann die Verantwortlichen und die Öffentlichkeit über (Zwischen-)Ergebnisse informiert werden,
- welche Entscheidungen im Verfahren die Beteiligten treffen können,
- welche Entscheidungen bei anderen Gremien liegen.
Die von mir so moderierten Beteiligungsverträge enden stets mit einer gemeinsamen Verpflichtung. Während die Beteiligten sich zu einer engagierteren, oft zeitintensiven Mitarbeit verpflichten, haben sie im Gegenzug Anspruch darauf, dass ihre Ergebnisse in den folgenden Entscheidungen ernsthaft gewürdigt werden. Dazu gehört insbesondere, dass ihnen die Gründe für Entscheidungen, die sich von den Ergebnissen unterscheiden, im Anschluss ernsthaft dargelegt werden.
Dieser do-it-or-explain-it Paragraph ist dabei der einzige nicht verhandelbare Bestandteil des Beteiligungsvertrages. Denn Beteiligung soll wirken. Sonst brauchen wir sie nicht.
Nichts spricht übrigens gegen eine formelle Unterzeichnung des Beteiligungsvertrages durch alle Akteure. Es stellt zugleich einen angemessenen gemeinsamen Auftakt für den folgenden Beteiligungsprozess dar.
Die Idee eines solchen Beteiligungsvertrages mag für manchen etwas sehr deutsch und überformalisiert klingen. Doch am Ende geht es auch gar nicht so sehr um die einzelnen Paragraphen, sondern um eine zentrale Botschaft: Wer „verhandelt“ statt „ansagt“, nimmt sein Gegenüber ernst.
Und um in der Spieltheorie zu bleiben: Regeln müssen nicht nur für alle gelten, sie müssen auch von allen getragen werden. Nur dann spielt man, auch wenn es Auseinandersetzungen gibt, am Ende „miteinander“.
Letztlich ist die von der Allianz Vielfältige Demokratie eingeforderte „sorgfältige Prozessgestaltung“ eben nicht die Auswahl einer verbindlichen Methode, sondern das Aufsetzen einer Prozessstruktur, die es ermöglicht, gemeinsam mit den Beteiligten eine jeweils optimale Methodenkombination zu finden und sie ggf. auch an Veränderungen anzupassen.
Da ist Methodenkompetenz bei den Beteiligenden, eventuell sogar eine methodisch erfahrene externe Prozessbegleitung hilfreich.
Ich selbst habe viele unterschiedliche Methoden in meinem persönlichen Baukasten, darunter klare Favoriten, Methoden mit breiter Einsatzmöglichkeit, spezielle Tools für den Umgang mit Störungen, Konflikten, aggressiven Stimmungen oder passiven Teilnehmer*innen. In über der Hälfte aller Fälle wende ich die vorbereitete Methode nicht exakt so an, wie geplant, oft wird sie spontan angepasst, ergänzt oder vollständig ersetzt.
Am Ende erfordert die Moderation insbesondere herausfordernder Beteiligungsprozesse eine möglichst praktische, umfassende Methodenkompetenz, eine hohe Bereitschaft, auf gruppendynamische Entwicklungen einzugehen, vor allem aber eine teilnehmer*innenzentrierte, zutiefst emphatische Haltung.
Denn ohne eine wertschätzende, ergebnisoffene, diskursorientierte Atmosphäre können selbst die besten Methoden ihre Möglichkeiten nicht entfalten.
Umgekehrt gilt: Wenn es eine offene, wertschätzende, integrative Moderation gibt, dann braucht es nicht zwangsläufig ausgetüftelte Methoden, markenrechtlich geschützte Formate und teure technische Ausstattungen.
Dann funktioniert auch mal ein schlichter Stuhlkreis.