Ausgabe #85 | 19. August 2021
Vom Wert der Renitenz
Demokratie ist dann stark, wenn sie Konflikte gemeinwohlorientiert anpackt, nicht umschifft.
Treuen Leser*innen könnte es aufgefallen sein: Ich beginne den heutigen Text, indem ich das Ende des Newsletters aus der vergangenen Woche zitiere. Das tue ich nicht, weil mir meine eigenen Sätze so ausnehmend gut gefallen würden, sondern weil in diesem einen Satz im Grunde das gesamte Dilemma unserer aktuellen demokratischen Misere steckt.
Und die Lösung.
Aber der Reihe nach. Denn offensichtlich gelingt es uns gerade nicht, diesen Anspruch einzulösen. Wir packen unsere Konflikte nicht an, nicht einmal im aktuellen Bundestagswahlkampf, gemeinhin die beste Zeit, um gesellschaftliche Herausforderungen zu thematisieren.
Die drei Spitzenkandidat*innen eiern um die Konflikte herum – und versuchen gleichzeitig, allen möglichen Teilmilieus Versprechungen zu machen.
Gemeinwohl geht natürlich anders.
Sie würden das nicht tun, wenn ihnen ihre Wahlkampfstrateg*innen nicht dazu geraten hätten. Und die würden nicht dazu raten, wenn sie nicht den Eindruck hätten, das nichtgemeinwohlorientierte Nichtanpacken von Konflikten sei die erfolgversprechendste Strategie.
Ein bisschen viel Verneinung im vorigen Satz, das gebe ich zu, aber so ist es eben: Der aktuelle Wahlkampf, die aktuellen Kandidat*innen, die aktuellen Parteistrateg*innen leisten nichts zur Stärkung unserer Demokratie. Man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich so verhalten. Sie wollen eben Wahlen gewinnen.
Das Problem ist, dass sich Wahlen im Jahre 2021 so gewinnen lassen.
So sieht die wirkliche Situation unserer Demokratie aus. Und genau das sollte uns alarmieren. Wenn man mit dem, was eine Demokratie ausmacht, was ihre Kernaufgabe ist, was ihre Stärke definiert, den wichtigsten Akt einer repräsentativen Demokratie nicht mehr erfolgreich bestreiten kann, dann ist der Tag nicht mehr weit, an dem die Lichter ausgehen.
Viele sehen das. Und viele machen sich Gedanken, wie diese Entwicklung zu stoppen ist. Mehr Partizipation ist eine beliebte Forderung, mehr Demokratie zwischen den Wahlen. Mehr Diskurs. Mehr Beteiligungsangebote. Und ja, das ist ein vielversprechender Weg.
Allerdings nur dann, wenn wir in diesen Prozessen nicht die Fehler der repräsentativen Entwicklung wiederholen. Ich wage es also ein drittes Mal:
Demokratie ist dann stark, wenn sie Konflikte gemeinwohlorientiert anpackt, nicht umschifft.
Das gilt auch – und ganz besonders – für Beteiligungsprozesse. Sie müssen zunehmend leisten, was die Parteiendemokratie nicht mehr leisten kann und will.
Das ist in der Praxis eine ganz erhebliche Herausforderung. Denn gerade unmittelbar persönlich betroffene Bürger*innen neigen dazu, ihre Partikularinteressen in solche Prozesse einzubringen und ihre eigene Sichtweise als unhinterfragt mehrheitsfähig zu sehen. Wir haben das im Kontext des Narzissmusbegriffs in den vergangenen Ausgaben von demokratie.plus diskutiert. Häufig sind die Beteiligten auch nicht demokratisch geschult und in einem wertschätzenden Umfeld zu Hause. Da wird manche Sichtweise schnell exklusiv, der Tonfall rau, der Diskussionsstil robust.
Das verleitet dazu, es bereits als Erfolg zu verbuchen, wenn eine einigermaßen erträgliche Debatte zustande kommt, Konflikte möglichst lautlos abgeräumt werden und wenn schon kein Konsens, so doch zumindest ein Einvernehmen hergestellt werden kann.
Am Ende aber ist so eine Strategie, so verständlich sie ist, genau das Gegenteil von dem, was Beteiligung leisten soll. Es geht eben nicht darum, alle oder möglichst viele Partikularinteressen zufriedenzustellen, sondern Konflikte gemeinwohlorientiert anzupacken.
Und Gemeinwohl ist eben nicht die Summe von Partikularinteressen, auch kein Kompromiss aus Partikularinteressen, auch keine Unterdrückung von Partikularinteressen.
Es ist das Gegenteil von Partikularinteressen.
Und das ist ohne Konflikt nie zu haben. Deshalb sind Konflikte so wichtig – und deren Thematisierung.
Und deshalb sind auch Kompromisse oder Konsense so uninteressant: Weil die Beteiligten weder ein Mandat dazu haben, für irgendeine nicht anwesende Gruppe zu sprechen, noch deren Zusammensetzung in irgendeiner Weise Mehrheitsprozesse legitimiert.
Das gilt für Abstimmungen, die in jedem guten Beteiligungsprozess tabu sein sollten, genau so wie für diskursiv hergestellte Mehrheiten. Selbst wenn 90 Prozent der Anwesenden mit einem hergestellten Einvernehmen gut leben könnten, sagt das noch lange nichts, aber auch gar nichts, darüber aus, ob das Ergebnis gemeinwohlorientiert ist.
Die aktuelle Forschung zur Effizienz von Teambildung in der Wirtschaft hat festgestellt, dass Teams mit unterschiedlichen Rollen besonders erfolgreich sind. Es gibt die Führungsfiguren, die Mitläufer*innen, die Bedenkenträger*innen, die Arbeitsbienen, die Integrator*innen. Untersucht wurde auch, welche Rolle am wichtigsten ist, indem man schaute, welche Rolle – wenn sie im Team NICHT vorkam, den Erfolg der Gruppe am stärksten schmälerte.
Es waren eben nicht die Führungspersönlichkeiten oder die sozial positiv Wirkenden. Es waren die Oppositionellen. Genau die, die das Team am meisten nervten, am störendsten empfunden wurden, auf die am liebsten alle anderen verzichtet hätten.
Warum? Weil sie den kollektiven Narzissmus blockierten, die vermeintliche Sicherheit verhinderten, weil sich alle einig wären, wäre das auch das bestmögliche Ergebnis. Weil sie disruptiv wirkten und verunsicherten. Und dabei war es völlig egal, wie sinnvoll, wie überzeugend, wie klug ihre Einwände waren. Allein der Zwang, sich mit unliebsamen Einwürfen auseinanderzusetzen, machte Teams erfolgreicher.
Ganz ähnlich ist es in Beteiligungsprozessen: Je konsequenter wir dafür sorgen, dass Minderheitsmeinungen zum Thema werden, desto größer ist die Chance, dass die Debatte irgendwann nicht mehr um das kreist, was die Mehrheit will, sondern um das, was als bestmögliche Lösung überzeugen kann – unabhängig davon, ob dies das Anliegen der Minderheit war oder ist.
Klingt irgendwie nach Homöopathie? Nach Stärkung der Wirkung durch Verdünnung? Mag sein. Funktioniert aber. Wenn Sie die Chance dazu haben, probieren Sie es mal aus.
Egal, ob im Team, in der Schule, im Vereinsvorstand, in der Parteigruppe oder im komplexen Beteiligungsprozess: Lokalisieren Sie Minderheitsmeinungen und geben Sie ihnen Raum. Und im entscheidenden Moment fragen Sie nicht „Und worauf können wir uns einigen?“, sondern „Und was wäre nun die bestmögliche Lösung?“
Versuchen Sie es. Es lohnt sich.
Schauen Sie zum Beispiel auf die gegenwärtige Klimadebatte: Wir brauchen dringend eine nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Doch wenn wir versuchen, diese mit Kompromissmanagement zu erreichen, wird das gleiche passieren wie in den vergangenen 50 Jahren, die seit der Veröffentlichung des Club of Rome Berichts zu den „Grenzen des Wachstums“ vergangen sind: nichts.
Genau deshalb ist diese Transformation die wohl größte Partizipationsaufgabe unserer Zeit. Und aus noch ein paar anderen Gründen. Doch darüber sprechen wir in der nächsten Woche.


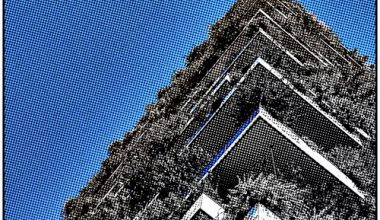


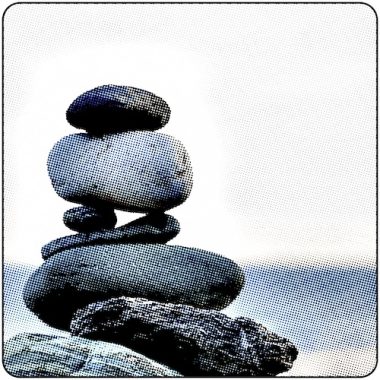



” … dann ist der Tag nicht mehr weit, an dem die Lichter ausgehen”? Herr Sommer, dieser Satz ist eines Demokraten unwürdig. Verstehen Sie diese Schwarzmalerei als “Konflikte gemeinwohlorientiert anzupacken”?
Was meinen Sie denn mit ‘die Lichter gehen aus’? Wessen Lichter? Die Lampen der demokratischen Erleuchtung? Dass Parteien schon immer Partikularinteressen vertreten haben und dies auch heute noch tun, ist nun wirklich keine neue Erkenntnis. Und dass unser deutsches Wahlsystem keine Garantie für tatsächlich gemeinwohlorientierte Kandidatenauswahl bietet, ist auch kein Geheimnis. Zu viele Absicherungen in jede politische, kulturelle, ideologische (Himmels-) Richtung machen Bewegung und damit Veränderung irgendwann unmöglich.
Wenn wir es aber als Aufgabe betrachten wollen, die “bestmögliche” Lösung herbei zu diskutieren, dann sollten wir vorher die Bewertungsmaßstäbe für das Bestmögliche klären. Wer und zu welchem Zeitpunkt entscheidet darüber, wie das Bestmögliche auszusehen hat? Die/Der Beste? Oder: Das Mögliche?
Den Oppositionellen Raum zu geben, ihnen zuzuhören und sich um Verständigung zu bemühen, ist sicher sinnvoll, aber nicht genug. Denn mit der Frage nach der bestmöglichen Lösung provoziert man nur die nächste Diskussion, nicht die Veränderung zum Besseren. Dazu bedarf es nämlich außerdem auch noch der Bereitschaft zur Mitwirkung an der Umsetzung. Dafür braucht es ein gemeinsames DAFÜR statt des immer wieder postulierten oppositionellen DAGEGEN Seins. Konfliktlösung, erst recht gemeinwohlorientierte Konfliktlösung, heißt TUN.
Ich glaube, ich habe es in diesem Newsletter insgesamt dreimal formuliert und hatte schon Sorge, es sei zu penetrant: “Demokratie ist dann stark, wenn sie Konflikte gemeinwohlorientiert anpackt, nicht umschifft.” Ich lese den zweiten Teil Ihres Kommentars so, als würden wir da ganz ähnlich denken. “Bestmöglich” im Sinne einer Gemeinwohlorientierung ist natürlich weder abstrakt noch absolut definierbar sondern immer wieder Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Nur müssen diese eben auch stattfinden. Wenn nicht, wenn unsere Politik quasi “entpolitisiert” wird, dann fördert dies demokratische Erosionsprozesse, die lange (vor allem für die politischen Eliten) erträglich bleiben, irgendwann jedoch eine ungeheurere Dynamik entfalten und eine Gesellschaft sprengen. Dann “gehen die Lichter aus”. Und angesichts des aktuellen Klimawandels ist das nicht nicht einmal nur ein abstrakte Formulierung. Und doch: Diese Perspektive ist nicht nur realistisch, sondern angesichts aller historischen Erfahrungen sogar wahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund ist die Erwähnung dieser Perspektive vielleicht sogar zu beiläufig erfolgt, “unwürdig” finde ich sie nicht.