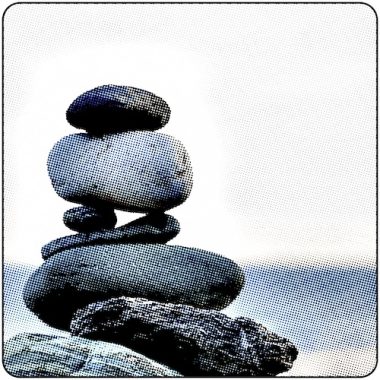Ausgabe #51 | 17. Dezember 2020
Nichtwissen als Chance
Sprechen wir über die Stärken und Schwächen unserer modernen Demokratie, schauen wir immer wieder gerne auf das alte Griechenland. Tatsächlich gab es dort Vieles, was wir heute in unserem politischen System kennen. Sogar die immer beliebter werdende politische Beteiligung von mehr oder weniger zufällig ausgewählten „einfachen“ Bürger*innen beruft sich gerne auf das antike Griechenland. Gemeint ist fast immer der Stadtstaat Athen, in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum zwischen den Perserkriegen und dem peloponnesischen Krieg – und auch dort war vieles ganz anders, als wir es heute kolportieren.
Doch wir wollen heute keine historische Vorlesung hören, sondern unser Thema aus der vergangenen Woche weiterdenken: Es ging um das „Risiko des Wissens“, also den Umgang mit praktisch immer vorhandenem Wissensvorsprung und mit Nichtwissen in Teilhabeprozessen. Sie erinnern sich? Wir schlossen mit der Feststellung, dass der Umgang mit Nichtwissen in einer Demokratie ein ganz entscheidender Resilienz-Faktor ist. Die Akzeptanz von Nichtwissen bei allen Beteiligten, die Erkenntnis, dass Wissen zwar absolut ist, der Umgang damit jedoch Verhandlungssache, schmerzt nicht nur Wissenschaftler*innen und Philosoph*innen. Sie ist aber Grundlage einer Demokratie.
Natürlich: Eine gefährliche Grundlage. Denn vom Nichtwissen zur Verweigerung von Wissen ist es nur ein kurzer Schritt. Noch einen winzigen Schritt weiter sind wir dann bei den „alternativen Fakten“, also dem „Wissen“ das sich, passend zur eigenen Überzeugung, selbst zusammenphantasiert wird. Dann aus der eigentlich passenden Bezeichnung „Wissensverweigerer“ ein schönes „Querdenker“ gemacht – und schon stoßen die Reaktionsmöglichkeiten unserer demokratischen Institutionen an ihre Grenzen.
Ein ähnlich kleiner Schritt, in eine nur geringfügig andere Richtung, ist der Schritt vom Nichtwissen zum Glauben. Er prägt noch immer, in Form der unterschiedlichsten Religionen, den weitaus größten Teil der Erdbevölkerung. Nicht überall haben sich Wissensgesellschaft und Glaubenskultur so weitgehend geschmeidig arrangiert, wie in den (christlichen) Nationen Europas. Das sah auch bei uns einmal ganz anders aus. Noch vor einer Zeit, die Weltgeschichtlich nur ein Augenzwinkern zurück liegt, konnte einem manch physikalisches Wissen vor die Inquisition treiben. Heute ist allgemein anerkannt, dass die Erde keine Scheibe ist. Doch die Wissensdecke ist dünn. In den USA sind auch heute noch wissenschaftliche Bücher aus manchen Schulbibliotheken verbannt, weil sie Darwins Entwicklung der Arten schildern – und nicht den Kreationismus der „göttlichen Schöpfung“. Auch bei uns ist die Grenze fließend. Nicht ohne Grund sind unter den „Querdenkern“ zahlreiche Mitglieder von Freikirchen und auch eine erkleckliche Anzahl von Anthroposophen vertreten.
Längst nicht jeder gläubige Mensch glaubt jeden Blödsinn. Und doch müssen wir feststellen: Nichtwissen, alternative Fakten und (Aber)glaube haben eine Verwandtschaft. Wie also sollen wir in einer aufgeklärten Demokratie damit umgehen? Denn erinnern wir uns: Wissen als Voraussetzung für Mitwirkung funktioniert nicht. Wir müssen Nichtwissen also akzeptieren – aber wir dürfen es nicht als Qualitätsmerkmal missverstehen. Nichtwissen ist keine Kompetenz. Aber Kompetenz ist eben auch keine notwendige Bedingung für Teilhabe.
Deshalb ist Wissensvermittlung auch keine Ouvertüre zu Beteiligung. Sie wird immer unvollständig, selektiv und potentiell manipulativ bleiben. Stattdessen sind Beteiligungsprozesse im Idealfall immer eine gemeinsame Erkenntnisreise, auch unter Einbeziehung externer, „wissender“ Expert*innen. Am Ende aber sind es die Beteiligten, nicht die Expert*innen, die in einem diskursiven Prozess ihr Alltagswissen, ihre Haltung und ihr Kollektiv erarbeitetes Wissen in ein Ergebnis einfließen lassen, so wie es zum Beispiel bei Formaten wie „Planungszellen“ und „Bürgergutachten“ konzeptionelle Grundlage ist.
Zentral ist dabei im Umgang mit Wissen und Nichtwissen eben die erwähnte Haltung. Wer den Nichtwissenden nicht akzeptiert oder sich auch nur minimal überlegen fühlt, bildet dies sehr schnell in seiner Prozessgestaltung und seinem Auftreten ab. Das aber führt schnell zu Reaktionen: Diskursverweigerung, eigene Fakten, Glauben als Bollwerk gegen Wissen. Das kann einzelne Debatten ebenso abwürgen wie es eine Debattenfähigkeit zum Beispiel zwischen politisch Verantwortlichen und „Querdenkern“ verhindert: Die Arroganz des Wissens trifft auf die Arroganz der Wissensverweigerung. Und nichts geht mehr.
Dabei ist Wissen am Ende immer nur Wissen auf Zeit. Mit wenigen Ausnahmen wurde alles, was Menschen jemals „wussten“, oft schon eine Generation später widerlegt. Deshalb ist es allein die Haltung, die uns über (vermeintliche) Wissensgrenzen hinweg Sprachfähigkeit erhält: Erkenntnis entsteht nie aus Wissen, sondern immer aus Widersprüchen. Ob diese Widersprüche nun einfach nur unangenehme Fragen sind, Gegenargumente, Generalkritik, Beschimpfungen oder Demonstrationen – sie alle sind eine Chance, gesellschaftliche Erkenntnis zu produzieren. Wenn unsere Haltung es zulässt. Das fällt uns nicht immer leicht, manchmal zu schwer. Aber zum Glück sind wir heute auch in diesem Punkt etwas weiter als die alten Griechen.
Die hatten zwar bereits mit Sokrates einen Philosophen, der sich exakt mit den Themen Wissen, Nichtwissen und Haltung beschäftigte. Für ihn war der Umgang mit Nichtwissen sogar eine ganz entscheidende Frage.Nachdem das Orakel von Delphi auch zu seiner Überraschung verkündet hatte, kein Mensch sei weiser als Sokrates, suchte der das Gespräch mit den klügsten Köpfen seiner Zeit. Dabei fand er schnell heraus, dass auch diese nicht vor Irrtümern gefeit waren:
„Beim Weggehen aber sagte ich zu mir: ‚Verglichen mit diesem Menschen bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß ja keiner von uns beiden etwas Rechtes; aber dieser glaubt, etwas zu wissen, obwohl er es nicht weiß; ich dagegen weiß zwar auch nichts, glaube aber auch nicht, etwas zu wissen. Um diesen kleinen Unterschied bin ich also offenbar weiser, dass ich eben das, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube.“
Sokrates kostete seinen Umgang mit Nichtwissen am Ende übrigens das Leben. Bezeichnenderweise angeklagt wegen Gottlosigkeit (die Demokratie in Athen war eben doch ganz anders als unsere) starb er den Gifttod.
Knapp 2.500 Jahre später sind die Herausforderungen im Kern noch dieselben. Das persönliche Risiko der Akteure, zumindest bei uns in Deutschland, ist geringer. Und doch ist die Verantwortung hoch: Wir dürfen nie akzeptieren, dass Debatten zwischen Teilen der Gesellschaft nicht möglich sind. Denn immer dann, wenn das in den vergangenen 2.500 Jahren der Fall war, ging das für die Gesellschaft – und damit auch für viele, viele Menschen böse aus. Deshalb bleibt unser Fazit heute:
Nichtwissen ist eine Chance, Nichtreden ist ein Risiko.