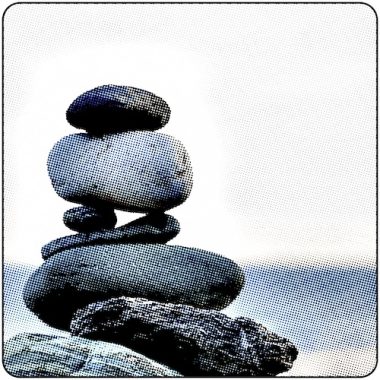Ausgabe #34 | 20. August 2020
Der Beteiligungsvertrag
Eigentlich ist sie ja ein Teilgebiet der Mathematik, auch wenn sie immer wieder gerne von Sozialwissenschaftlern bemüht wird: Die Rede ist von der so genannten Spieltheorie. Begründet wurde sie in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts u. a. von dem ungarischen Mathematiker John Neumann, der wie so viele seiner Generation vor den Nazis in die USA flüchtete. Dort war er einer der Entwickler der Atombombe. Ähnlich universal denkend wie sein Freund Albert Einstein entwickelte er wichtige Impulse in ganz unterschiedlichen Feldern der Physik, Mathematik, Informatik, Ökonomie und in den Gesellschaftswissenschaften.
Selbst heute, über 60 Jahre nach seinem Tod, kann er uns dabei helfen, unsere Demokratie besser zu verstehen. Denn die von ihm maßgeblich inspirierte Spieltheorie liefert, angelegt an die moderne Praxis der Bürgerbeteiligung, eine ganze Reihe spannender Impulse.
Damit wären wir auch schon beim Thema unseres heutigen Newsletters. Es geht, wie auch schon in den vergangenen Wochen, um die zehn Grundsätze Guter Beteiligung, wie sie die Allianz Vielfältige Demokratie entwickelt hat. Heute wollen wir uns dem siebten Prinzip widmen. Es lautet:
Gute Bürgerbeteiligung erfordert die gemeinsame Verständigung auf die Verfahrensregeln.
Betrachten wir einen typischen Beteiligungsprozess spieltheoretisch, wird dieser Grundsatz rasch in seiner elementaren Bedeutung erkennbar. Natürlich kann ein „Spiel“ nur dann funktionieren, wenn alle Beteiligten die Regeln nicht nur kennen, sondern sich auch daran halten. Das ist um so wichtiger, wenn bei fundamentalen Regelverstößen wenig Sanktionsmöglichkeiten bestehen. Während man diese im Wilden Westen noch drastisch ahndete und den Falschspieler gerne mal teerte und federte oder auch gleich direkt am Spieltisch erschoss, sind die Sitten heute erheblich zivilisierter geworden.
Im Fußball sorgen gelbe und rote Karten für die nötige Disziplin, in vielen anderen Ballsportarten gibt es Zeitstrafen, immer aber als ultima ratio den Platzverweis oder die Disqualifikation, ausgesprochen von mehr oder weniger neutralen Schiedsrichtern.
Beides haben wir in der Bürgerbeteiligung nicht.
Umso wichtiger ist es, dass über die Regeln des Beteiligungsprozesses Einvernehmen besteht. Zu klären ist u. a.
- der Umgang der Akteure miteinander,
- der Gegenstand des Beteiligungsprozesses,
- Zweck, Verlauf und Formen der Beteiligung,
- Wege der Dokumentation,
- sowie der Umgang mit den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses.
Wichtig ist dabei das Wort Einvernehmen. Denn anders als bei einem klassischen Brettspiel sind diese Regeln in Beteiligungsprozessen eben nicht vorher aufwändig entwickelt, getestet, modifiziert und schriftlich fixiert.
Tatsächlich sieht das in der Praxis häufig anders aus: Die Regeln werden von der beteiligenden Institution aufgestellt. Sie definiert Umfang, Dauer, Ressourcen, oft auch Formate und einzelne Prozessschritte. Dies geschieht manchmal unter Beteiligung von Experten und Dienstleistern. Bisweilen werden sogar fertige, standardisierte „Formate“ eingekauft.
Werden dann noch die Beteiligten vollständig „rekrutiert“, ist die Gefahr groß, dass der ganze Prozess in Schieflage gerät, insbesondere dann, wenn es um die Akzeptanz von Vorhaben und Planungen geht, bei denen das „ob“ im Grunde gar nicht mehr zur Disposition steht – und das ist nicht selten der Fall.
Übersetzen wir ein solches Beispiel einmal in die Spieltheorie. Dies würde in etwa folgender Konstruktion entsprechen: Ein Spieler entwickelt die Spielidee, schreibt sämtliche Regeln, entscheidet über die Ressourcenverteilung und lädt dann andere Spieler zur Teilnahme ein, vorausgesetzt, sie akzeptieren seine Regeln und die Tatsache, dass es für sie persönlich im Grunde gar nichts zu gewinnen gibt. Niemand würde wohl erwarten, hier tatsächlich gutwillige Mitspieler zu finden.
Warum sollte das dann in der Bürgerbeteiligung anders sein?
Natürlich kann diese Methode funktionieren, insbesondere dann, wenn es nicht um Konfliktthemen geht, sondern um eher grundlegende Diskurse, die die Teilnehmenden nicht in Kategorien von „Sieg“ oder „Niederlage“ denken lässt. Dies ist übrigens eine der Stärken von Beteiligung mit Zufallsrekrutierung – solche Verfahren verzeihen in der Regel deutlich mehr methodische Schwächen als Betroffenenbeteiligung.
Doch auch hier gilt eigentlich die ethische Maxime: Regeln für eine soziale Interaktion auf Augenhöhe sollten grundsätzlich einvernehmlich von allen Beteiligten getragen werden.
Deshalb empfehle ich seit langer Zeit in allen Beteiligungsprozessen unabhängig von Größe, Dauer und Umfang, an den Anfang einen formellen „Beteiligungsvertrag“ zu setzen. In ihm sind grob die wichtigsten gemeinsamen Spielregeln fixiert. Dazu gehört u. a.
- wie der Prozess abläuft,
- aus welchen Bausteinen er besteht,
- welche Methode(n) eingesetzt werden,
- welche Rechte und Pflichten die Beteiligten haben,
- wie ggf. Anpassungen des Verfahrens an neue Herausforderungen oder Erkenntnisse vorgenommen werden können,
- welche Phasen des Beteiligungsprozesses öffentlich und welche intern sind,
- wie die Ergebnisse dokumentiert und bekanntgegeben werden,
- wann die Verantwortlichen und die Öffentlichkeit über (Zwischen-)Ergebnisse informiert werden,
- welche Entscheidungen im Verfahren die Beteiligten treffen können
- und welche Entscheidungen bei anderen Gremien liegen.
Die von mir so moderierten Beteiligungsverträge enden stets mit einer gemeinsamen Verpflichtung. Während die Beteiligten sich zu einer engagierteren, oft zeitintensiven Mitarbeit verpflichten, haben sie im Gegenzug Anspruch darauf, dass ihre Ergebnisse in den kommenden Entscheidungen ernsthaft gewürdigt werden – und dass die Gründe für Entscheidungen, die sich von den Ergebnissen unterscheiden, ihnen im Anschluss ebenso ernsthaft dargelegt werden. Dieser „do-it-or-explain-it“ Paragraph ist dabei der einzige nicht verhandelbare Bestandteil des Beteiligungsvertrages.
Denn Beteiligung soll wirken. Sonst brauchen wir sie nicht.
Nichts spricht übrigens gegen eine formelle Unterzeichnung des Beteiligungsvertrages durch alle Akteure, zugleich ein angemessener gemeinsamer Auftakt für den folgenden Beteiligungsprozess.
Die Idee eines solchen Beteiligungsvertrages mag für manchen etwas sehr deutsch und überformalisiert klingen. Doch am Ende geht es auch gar nicht so sehr um die einzelnen Paragrafen, sondern um eine zentrale Botschaft:
Wer „verhandelt“ statt „ansagt“, nimmt sein Gegenüber ernst.
Und um in der Spieltheorie zu bleiben: Regeln müssen nicht nur für alle gelten, sie müssen auch von allen getragen werden. Nur dann spielt man, auch wenn es Auseinandersetzungen gibt, am Ende „miteinander“.
Und genau darum geht es.