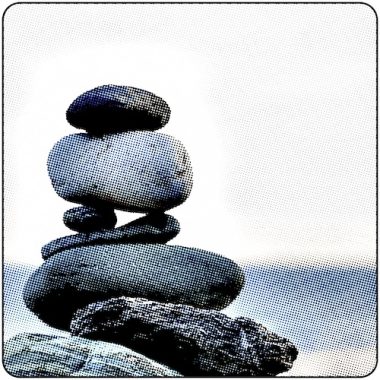Ausgabe #53 | 7. Januar 2021
Keine Frage der Regeln
Der von mir persönlich gemessene Rekord steht bei 88 Minuten.
So lange brauchte Anfang Dezember ein Moderator, um die von ihm moderierte Methode auch dem letzten Teilnehmer zu erklären.
Eingesetzt werden sollte das „Dragon Dreaming“ Format. Eigentlich ein recht spannendes Format, das die Mitwirkenden zu „gemeinsamem Träumen“ anleiten soll und gerne in Gemeinschaftsentwicklungsprojekten eingesetzt wird.
Entwickelt wurde das Format von John Croft im Rahmen eines Entwicklungsprojektes in Papua-Neuguinea. Die Geschichte dazu ist ebenso spannend wie der sehr emphatische Ansatz.
Zwischenzeitlich hat sich rund um diese Methode jedoch etwas entwickelt, was wir bei vielen ähnlichen Tools beobachten: Die Herausbildung (und Pflege) einer Marke – mit “qualifizierten Dragon-Dreaming-Trainer*innen“, Ausbildungen mit Tagessätzen im vierstelligen Bereich sowie einem immer komplexeren Regelwerk.
Das gibt es bei unterschiedlichen Methoden-Marken, häufig aus zwei Gründen: Einerseits soll es die teilweise hochpreisigen Lehrgänge für Moderator*innen rechtfertigen, andererseits soll es eben auch weniger begabten und erfahrenen Moderator*innen ermöglichen, sich mit dieser Methode durch einen Prozess zu hangeln.
Am Ende kann dies dann dazu führen, dass alleine das Verständnis der Methode und ihrer Regeln unter den Mitwirkenden bereits eines ungeheuren Aufwandes bedarf. Dass dies dann üblicherweise in Form eines methodisch wenig ausgetüftelten Frontalvortrages geschieht, ist eine Pointe für sich.
Rund 90 Minuten später haben wir dann eine suboptimale Ausgangsposition: Ein Teil der Mitwirkenden hat noch immer nicht verstanden, was von ihm nun verlangt wird, ein anderer ist zwischenzeitlich aus Langeweile beinahe ins Koma entglitten, einem anderen Teil ist jede Mitwirkungsmotivation abhanden gekommen.
Noch dazu war in dem von mir erwähnten Fall weder das Thema (Entwicklung eines Wahlprogramms) noch der Teilnehmer*innenkreis (gestandene Kommunalpolitiker) optimal für den Einsatz gerade dieser Methode – die in anderen Fällen durchaus auch von mir empfohlen und (in modifizierter Form) eingesetzt wird.
Alles in allem ein typischer Fall von methodischem Suizid, wie er in der Beteiligungslandschaft nicht die Regel, aber eben auch nicht gänzlich die Ausnahme ist.
Tatsächlich ist die Auswahl des richtigen Formates keine triviale Sache. So schreibt die Allianz Vielfältige Demokratie in ihrer Broschüre zu den Grundsätzen Guter Beteiligung u. a.: „Zur konkreten Umsetzung ist eine sorgfältige Wahl der Methoden und Verfahren wichtig. Ein erfolgreicher Beteiligungsprozess beruht häufig auf der passgenauen Kombination verschiedener Elemente.“
Dabei sind es oft wenig beachtete kleine Justierungen, die eine wertschätzende Kommunikation der Beteiligten erleichtern – oder verhindern können. Der berühmte „Runde Tisch“, medial besonders herausstechend in der heißen Phase der „Wende“ in der ehemaligen DDR, wurde der Sage nach schon über 800 Jahre zuvor als cleveres Beteiligungsformat eingesetzt – von König Artus, dessen engste Gefolgsleute überwiegend heißblütige, ehrversessene „Edelmänner“ gewesen sein sollen.
Die testosterongetriebene Männertruppe wäre wohl rasch auseinandergefallen, hätte Artus nicht mit einem simplen Coup für Augenhöhe gesorgt: Mit einem runden Tisch, der Tafelrunde, die keine besseren oder schlechteren Platzierungen kannte. Damals ging es darum, Konflikte zu vermeiden. Heute werden Runde Tische gerne eingesetzt, um existierende Konflikte zu entschärfen – oder gar so zu tun, als gäbe es sie nicht.
Keine Runden Tische gibt es übrigens bei Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Im Gegenteil: Dort sitzen sich seit über 100 Jahren gerne mal bis zu 60 Vertreter*innen auf jeder Seite an langen Tischreihen mit großem Abstand gegenüber. Der Grund: Jede Tarifpartei ist darauf bedacht, Stärke und Konfliktbereitschaft zu zeigen und die eigenen Reihen geschlossen zu halten.
Wir sehen also: Schon eine so simple Sache wie die Auswahl der passenden Tischform hat Auswirkungen auf Verlauf und Ergebnis demokratischer Prozesse.
Die Frage liegt auf der Hand: Wie kann man, besonders in komplexen Prozessen, alle relevanten Formatentscheidungen vorher treffen, optimale Methoden auswählen, Prozesse optimal planen, entscheidende Details festlegen und Fehler vermeiden?
Die Antwort lautet: gar nicht.
Denn bei aller (mehr oder minder deutschen) Prozessverliebtheit: Ein demokratischer Prozess ist nur dann ein demokratischer Prozess, wenn er eben nicht vollständig durchkomponiert ist.
Ohnehin ist die Wahl der „richtigen“ Methode weitaus weniger wichtig für ein Gelingen, als oft vermutet.
Ein ernsthaft betriebener Beteiligungsprozess, ob mit losbasierten Teilnehmer*innen oder als offene Betroffenenbeteiligung konzipiert, mit transparenten Informationen, klarer Kommunikation über den realen Mitwirkungsumfang, unter positiver, wertschätzender Mitwirkung der Entscheider, mit einer neutralen, kompetenten und teilnehmerzentrierten Moderation, wird funktionieren, selbst wenn in Teilen unsauberere und suboptimale Methoden eingesetzt werden.
Die Wahrheit lautet: Es gibt keine universellen Methoden mit Erfolgsgarantie, auch wenn einzelne Dienstleister oder Urheber dies anders darstellen. Es gibt geeignetere und ungeeignetere Methoden, aber letztlich ist es eine Frage der Haltung der Beteiligenden und der Kompetenzen der Moderation. Ein wichtiger Bestandteil dieser Kompetenzen ist eine selbstkritische Grundeinstellung und eine gesunde Respektlosigkeit vor Methodenjüngern aller Art.
Gute Beteiligung ist weniger eine Frage der Methode, sondern eher der Haltung.
Tatsächlich unterscheiden sich Beteiligungsprozesse ganz erheblich von didaktischen Formaten. In beiden werden zwar Methoden angewandt, teilweise sogar dieselben. Während in didaktischen Zusammenhängen die Methode jedoch allgemein vom Lehrenden gesetzt und von den Teilnehmer*innen akzeptiert wird, muss die Moderation in Beteiligungsprozessen jederzeit bereit sein, die Methodik ausführlich zu begründen.
Insbesondere in konfliktgetriebenen Verfahren ist eine Grundskepsis vieler Teilnehmer*innen zu beobachten. Und sie ist berechtigt.
Gerade ausgefeilte Methoden haben in der Didaktik ein klar definiertes Ziel: Meist ist es Wissens- oder Kompetenzvermittlung, oft auch ein Hinterfragen oder gar modifizieren von Haltungen. Was in der Didaktik als gewünschter Effekt angestrebt wird, kann in Beteiligungskontexten als manipulativ wahrgenommen werden. Deshalb haben Methoden in der Beteiligung prinzipiell eher den Charakter von Vorschlägen als von Vorgaben.
Das aber ist eine besondere Herausforderung an die Moderation (und oft auch an die mentale, finanzielle und zeitliche Flexibilität der beteiligenden Institution). Denn Vorschläge sind nur dann Vorschläge, wenn sie abgelehnt werden können.
Am Ende sind Moderator*innen mit ihren Methodenvorschlägen nicht dem Auftraggeber verpflichtet, sondern den Mitwirkenden. Denn ihr Job ist es, den Beteiligten optimale Diskurse zu ermöglichen, nicht irgendeine bis ins Detail ausgetüftelte Methode durchzumoderieren.
Das ist nicht immer einfach, insbesondere wenn Auswahl und Auftragserteilung zuvor mit einer bestimmten Methode verknüpft wurden. Dann wird die Sache herausfordernd – aber nicht unlösbar.
Was dabei hilft? Ein Blick in die so genannte Spieltheorie. Demokratische Prozesse sind zwar eine durchaus ernsthafte Angelegenheit, aber sie sind auch ein Spiel. Es gibt oft Gewinner und Verlierer, mehrere Runden, Spielregeln und Schummler.
Wie uns die Spieltheorie dabei hilft, politische Teilhabe besser zu organisieren, das schauen wir uns in der kommenden Woche gemeinsam an.