Ausgabe #155 | 22. Dezember 2022
Tingstens Gesetz
Als der Schwede Herbert Lars Gustaf Tingsten 1973 starb, hatte er einen beindruckenden parteipolitischen Lebenslauf aufzuweisen.
Als Jugendlicher war er ein strammer Konservativer, wandelte sich später zum Linksliberalen, um dann mit Ende Zwanzig in die sozialdemokratische Partei einzutreten.
Tingsten gehörte dort zur radikalen, marxistischen Fraktion innerhalb der Partei. Er kämpfte für die Verstaatlichung der Industrie. Dann wechselte er erneut die Meinung und verließ, als glühender Anhänger der Freien Marktwirtschaft, 1945 die Partei.
Schließlich gründete er eine wirtschaftsliberale Vereinigung und versuchte, Schweden in die NATO zu bringen.
Herbert Tingsten wechselte im Laufe seines Lebens in recht kurzen Abständen seine politischen Überzeugungen.
Gleichzeitig formulierte er als Wissenschaftler Hypothesen und gewann Erkenntnisse, die bis heute wirken. Er hat die moderne Wahlforschung geprägt wie nur wenige andere.
Schon 1937 formulierte er das so genannte „Gesetz der Streuung“, das den Zusammenhang zwischen sinkender Wahlbeteiligung und steigender sozialer Ungleichheit unterstreicht.
Vereinfacht gesagt gibt es laut Tingsten einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und niedriger Wahlbeteiligung. Dieser Zusammenhang ist noch dazu dynamisch: Je niedriger die allgemeine Wahlbeteiligung, desto größer die Streuung.
Die Bertelsmann-Stiftung untersuchte 80 Jahre später diese Hypothese im deutschen Kontext. Ihr Ergebnis ist durchaus kompatibel mit Tingstens Gesetz:
Vor allem einkommensschwache und bildungsferne Teile der Bevölkerung verabschieden sich aus der aktiven Teilhabe an der Demokratie.
Die Wahlenthaltung geschieht jedoch weniger aus Frust oder Protest.
Stärkste Ursache für Wahlmüdigkeit ist vielmehr Gleichgültigkeit – je geringer der Sozialstatus und je größer das politische Desinteresse im Freundeskreis, desto weniger wahrscheinlich wird der Gang zur Wahlurne.
Inzwischen sind die Ausmaße des Phänomens erheblich.
Demokratie im Sinne der Teilhabe an Wahlen findet heute nur noch für eine Minderheit unserer Bevölkerung statt.
Von über 80 Millionen Menschen in Deutschland haben gerade mal rund 12 Millionen die Partei des aktuellen Bundeskanzlers gewählt.
Mehr als 14 Millionen wahlberechtigte Menschen gaben dagegen ihre Stimme nicht ab. Bei Landtags- und Kommunalwahlen sind die Zahlen teils noch dramatischer, oft nimmt weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten teil.
Der Umgang mit dieser Entwicklung ist im politischen Raum unterschiedlich.
Die Gewählten neigen dazu, die mangelnde Wahlbeteiligung für wenige Tage laut zu beklagen, haben sich damit aber im Prinzip arrangiert. So lange Wahlen zu Ergebnissen führen, die allgemein akzeptiert sind, passt es.
Politische Aktivist*innen bis hin zu Bewegungen, die unser politisches System vollständig ablehnen, neigen dazu, die Nichtwähler*innen als Protestsignal zu interpretieren.
Beide Sichtweisen sind problematisch.
Denn beide suggerieren eine lebendigere Demokratie, als es der Realität entspricht. Wenn ein großer Teil, tendenziell sogar die Mehrheit der Menschen, ihr höchstes demokratisches Grundrecht nicht ausübt – und dies nicht als Form (demokratischen) Protests, sondern aus Gleichgültigkeit gegenüber den Institutionen, Prozessen und Akteuren der Demokratie …
… dann sollten alle Alarmglocken klingeln.
Demokratien haben immer Gegner. Aber sie können von diesen nur dann zur Strecke gebracht werden, wenn die Menschen kein Interesse mehr an ihr haben.
Diesem Stadium nähern wir uns weiter an. Deshalb ist es so wichtig, unsere Demokratie zu beleben, deshalb sprechen wir über neue Formen politischer Teilhabe. Deshalb praktizieren wir in Deutschland (und vielen anderen Demokratien) Bürgerbeteiligung.
Das ist gut. Doch wir dürfen uns auch hier nichts schönreden, was nicht stattfindet.
Denn Bürgerbeteiligung hat viele positive Effekte. Oder kann sie haben, wenn sie gut gemacht ist. Sie kann Vorhaben besser machen, Konflikte bearbeitbar, Akteure akzeptierter.
Sie kann auch die Demokratie wiederbeleben, sogar die Wahlbeteiligung heben.
Dazu aber müssen wir nicht nur gut beteiligen. Wir müssen auch die Richtigen beteiligen.
In der Praxis werden häufig genau jene Milieus beteiligt, die ohnehin wählen und auch der Sozialstruktur der Gewählten auffallend ähnlich sind.
Beteiligung ist oft politisches Engagement. Und Engagement ist das Gegenteil von Desinteresse. Die Engagierten in Parlamenten, Vereinen und anderen gesellschaftlichen Wirkungsfeldern sind leichter ansprechbar, trauen sich mehr zu, wollen mehr wirken.
Sie zu beteiligen ist sinnvoll. Die demokratiefördernde Wirkung aber überschaubar.
Wer beteiligen will, um Demokratie zu stärken, muss die Desinteressierten beteiligen.
Dazu aber braucht es andere Themen (nämlich jene, die sie betreffen), andere Formate (ohne systemische Vorteile für gebildete und rhetorische Bewanderte) und andere Formen der Ansprache (aufsuchend statt abwartend).
Tatsächlich gibt es hier durchaus positive Erfahrungen. Wir wissen, wie das geht. Wir praktizieren es nur zu wenig.
Noch immer ist die Beteiligung in Deutschland überwiegend Vorhabenbasiert. Öffentliche oder private Akteure wollen (oder müssen) gestalten, also beteiligen sie andere Akteure, um diese Gestaltung partizipativ zu begleiten.
Dabei bleibt der ganze Prozess zwischen Beteiligenden und Beteiligten oft im selben Milieu. Im Sinne einer „breiten“ Beteiligung wird teilweise versucht, gezielt auch „beteiligungsferne“ Gruppen anzusprechen.
Unsere Beteiligungskultur leistet hier einiges. Demokratieförderung zählt nicht zu ihren Prioritäten.
Stattdessen verstehen unsere politischen Entscheider*innen Demokarteiförderung nahezu ausschließlich als „Extremismusprävention“, Ob Förderprogramme oder das neue „Demokratiefördergesetz“: Im Fokus steht nicht, die Desinteressierten zu interessieren, sondern die Gefährlichen zu isolieren.
Beide Ansätze sind wichtig, ja sogar unentbehrlich. Aber beide sind nicht die Antwort auf die Gefährdung der Demokratie durch Desinteresse.
Darüber denken wir gerade zu wenig nach.
Es gibt spannende Projekte und gute Erfahrungen in der beteiligungsorientierten Demokratieförderung bei Kindern und Jugendlichen. Sie zeigen, was möglich wäre – wenn man es systematisch angehen würde.
Denn tatsächlich ist der Ansatz ebenso einfach, wie ehrgeizig. Wer Demokratie stärken will, muss nicht nur Extremisten bekämpfen, sondern vor allem das Desinteresse.
Das geht über Beteiligung zu den Themen, die für die Betreffenden wichtig sind (nicht zwangsläufig auch für Politik und Vorhabenträger).
Wir müssen also die Richtigen zu den richtigen Themen beteiligen. Und vor allem: Viele davon.
Sehr viele. Sehr oft. Sehr ernsthaft.
Und wir sollten sehr schnell damit anfangen.





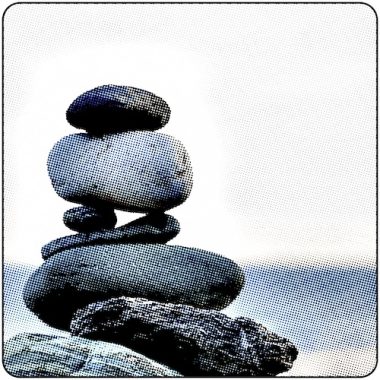



“zu den richtigen Themen” beteiligen bedeutet in der Praxis fast immer: im direkten Wohnumfeld der Bürger*innen.
Hinzu kommt die Notwendigkeit, verstärkt Beteiligungsprozesse mit einem deutlich (!) reduzierten Planungshorizont zu setzen. Der/die Durchschnittsbürger*in ist fast nie an einem mehrjährigen Bebauungsplanprozess interessiert, an einer kurzfristigen Neugestaltung des Spielplatzes in der Nachbarschaft (mit einem zeitnah sichtbaren Ergebnis) aber schon.
Nimmt man aufsuchende/vor-Ort-Beteiligungsmethoden hinzu, funktioniert das recht gut.