Ausgabe #72 | 20. Mai 2021
Die Nichtrepräsentanten
Die Nichtrepräsentanten
Die Gründer*innen waren grundverschieden. Und sie waren sich nicht in vielen Dingen einig.
Gemeinsam war ihnen aber die tiefe Skepsis gegenüber dem repräsentativen System, ihren Institutionen und den Politiker*innen der etablierten Parteien.
Klar war also: Die neue Partei sollte eine „Antiparteien-Partei“ werden. Mit ganz neuen Formen der innerparteilichen Meinungsbildung:
Absolut basisdemokratisch.
Debatten und Konsenssuche sollten sie prägen. Und würde die Partei einmal in Parlamente einziehen, wolle man die Abgeordneten an der ganz kurzen Leine halten, durch Rotation und imperatives Mandat dafür sorgen, dass sie der Basis verbunden bleiben und nicht zu Berufspolitikern würden.
Auf dem Gründungsparteitag gab es donnernden Applaus für die Feststellung: „Zum ersten Mal bietet sich die Chance, die verkrustete Parteienstruktur der Bundesrepublik von innen her aufzubrechen.“
Die Mitgliedschaft war bunt zusammengewürfelt: Gescheiterte aus anderen Parteien und politischen Splittergruppen, Ex-Militärs, Homöopath*innen, Verschwörungstheoretiker*innen, Notorische Querulant*innen, Esoteriker*innen jeder Couleur, schlicht Bekloppte und wegen politischer Aktionen einschlägig Vorbestrafte, Amerika-Hasser*innen und Russland-Freund*innen…
Sie ahnen, um welche Partei es geht?
Es waren die GRÜNEN. Als sie sich 1980 in Karlsruhe offiziell gründeten, waren die politischen Parteien im Deutschen Bundestag entsetzt, aber hoffnungsvoll. Diese Chaotentruppe würde es nie in die Parlamente schaffen und bald schon in der Versenkung verschwinden.
Die weitere Geschichte ist bekannt.
Schon drei Jahre später zogen die ersten Parteimitglieder in den Bundestag ein. Im kommenden Herbst stellt diese Partei, heute völlig anders aufgestellt, eventuell die Bundeskanzlerin.
Spulen wir also vom Gründungsparteitag der GRÜNEN 40 Jahre nach vorn. Im Herbst 2020 gründete sich eine weitere neue Partei.
Die Gründer*innen waren grundverschieden. Und sie waren sich nicht in vielen Dingen einig.
Gemeinsam war ihnen aber die tiefe Skepsis gegenüber dem repräsentativen System, ihren Institutionen und den Politiker*innen der etablierten Parteien.
Klar war also: Die neue Partei sollte eine „Antiparteien-Partei“ werden. Mit ganz neuen Formen der innerparteilichen Meinungsbildung: Absolut basisdemokratisch. Debatten und Konsenssuche sollten sie prägen…
Den Rest kennen Sie schon.
Die Partei nennt sich „Die Basis“. Ihre Zusammensetzung ist ähnlich bunt, wie jene der GRÜNEN 40 Jahre zuvor. Die Reaktion der etablierten Parteien – inklusive der GRÜNEN – ebenfalls:
Eine Mischung aus Ignoranz, Belustigung, Abscheu und einem ganz leichten Anflug von Panik.
Nichts liegt mir ferner, als die beiden Parteien vergleichen zu wollen. Ich bin befangen. Mit den politischen Zielen der GRÜNEN verbindet mich weit mehr als mit den verquasten Weltbildern vieler BASIS-Akteure.
Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Auch nicht um Rituale, wie sie kürzlich auf dem ersten Bundesparteitag praktiziert wurden und die uns ebenfalls an grüne Selbsterfahrungen aus der Frühzeit erinnern:
Eine gemeinsame „Baum-Meditation“ sollte für eine gesunde Erdung der Delegierten sorgen: „Geht in Verbindung mit der Erde unter Euch“ forderte die Moderatorin die Anwesenden auf.
Dann sprach sie von Strömen Richtung Universum, Herzensenergien und einem „morphogenetischen Feld“, das die Gedanken aller Anwesenden miteinander verbinde.
Ja, auch die BASIS hat ihre Spinnereien. Sie zieht „Querdenker*innen“, Corona-Leugner*innen und Impfgegner*innen an. Sie hat aber auch Ideen, die nicht unbedingt neu sind, die aber in ihrer Konsequenz eine neue Qualität in der Parteienlandschaft darstellen.
So hat sie nicht nur Beauftragte für „Schwarmintelligenz“, „liebevollen Umgang“ und „Machtbegrenzung“, sondern in ihrer Satzung auch einen faszinierenden Paragraphen 3 mit dem Titel „Konsensierung“.
Sie will strittige Fragen nicht per einfacher Mehrheitsentscheidung klären, sondern mittels der Methode des „Systemischen Konsensierens“ versuchen, eine für möglichst viele tragbare Lösung zu finden.
Diese Methode ist älter als die Partei. Schon die PIRATEN und in geringem Umfang auch die GRÜNEN haben damit experimentiert. Neu ist die Konsequenz, mit der die BASIS diese Methode einsetzt (wie auch noch weitere Formate, die wir aus der Bürgerbeteiligung kennen).
Systemisches Konsensieren ist dabei kein einfacher Prozess. Die genaue Methodik wird hier sehr gut erklärt:
Im Grunde geht es darum, eine Lösung zu finden, die den geringsten Widerstand und die wenigsten Frustrationen auslöst.
Ob dieser Partei ein ähnlicher Weg wie den GRÜNEN bevorsteht, bleibt offen. Ob es ihr gelingt, sich inhaltlich von diversen absurden Positionen zu befreien, ebenfalls. Genau wie die Frage, ob auch sie ihre alternativen Ansätze im Umgang mit Macht und Mehrheiten auf diesem Weg zurücklässt.
Bis dahin aber lohnt es sich für jeden, der sich mit der Revitalisierung unserer demokratischen Kultur beschäftigt, genau hinzuschauen, welche Erfahrungen diese Partei sammelt, und:
Was wir von ihr lernen können.
Ja, die Partei zieht auch Spinner an. Ja, sie hat kaum realistische Forderungen. Ja, manche davon sind brandgefährlich. Und ja: Sie kann krachend scheitern.
Aber kluge Menschen lernen aus dem Scheitern. Auch aus dem Scheitern Anderer. Wir wären als Demokraten schlecht beraten, wenn wir dieses Angebot der BASIS nicht nutzen würden.
Und wenn Sie einmal Zeit haben: Schauen Sie sich das Systemische Konsensieren einmal genauer an. Es lohnt sich.
Und es funktioniert.
Nicht nur in Parteien. Auch in Beteiligungsprozessen aller Art. Auch in Teams, in Wohngemeinschaften, und: in Familien. Wohl das beste Labor, um es einfach einmal auszuprobieren.



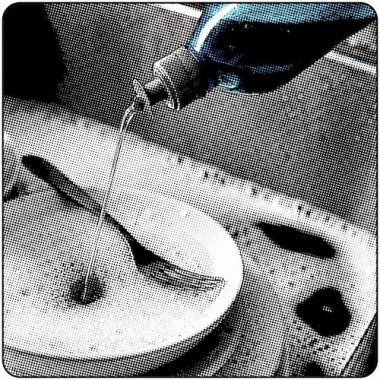
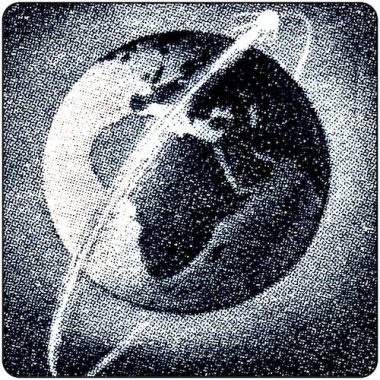


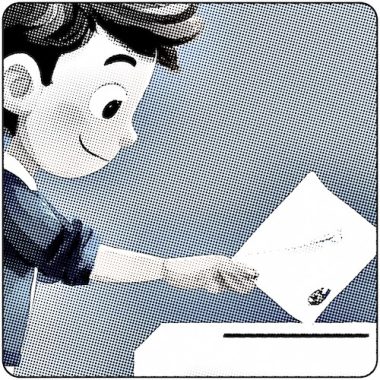

Lieber Herr Sommer, in Bezug auf die Grünen bin ich nicht Ihrer Meinung. Ja, es gab viele, die aus anderen Parteien kamen. Sie waren aus meiner Sicht nicht „gescheitert“, sondern enttäuscht. In vielen Städten waren die Grünen ein Auffangbecken für von Helmut Schmidts Politik enttäuschte SPD-Mitglieder, insbesondere – aber nicht nur – Jusos. Noch mehr der Gründungsmitglieder hatten sich vor Gründung der Grünen in keiner Partei, sondern ausschließlich in der Umwelt-, Frauen- und Friedensbewegung sehr professionell und mit engem Basisbezug engagiert. Sie waren es, die der Partei zum Erfolg und zum Einzug in die Parlamente verhalfen.
Liebe Ute Finckh-Krämer,
tatsächlich ist es eine der Gründungs-Mythen der GRÜNEN, sie seien quasi „aus der Bewegung entstanden“. Das trifft auch durchaus für viele Mitglieder zu, die kurz nach der Gründung dazustießen.
Vorangetrieben wurde die Gründung aber (und die Partei von Anfang an maßgeblich beeinflußt) u.a. von ehemaligen Parteifunktionären der SPD, der CDU und insbesondere Kader aus diversen kommunistischen, trotzkistischen und maoistischen Splittergruppen (von denen es dann ja Jahre später einige auch einige zu Mitgliedern der Bundesregierung oder Ministerpräsidenten brachten). Von diversen, teilweise durchaus einflussreichen Akteursgruppen wie zum Beispiel den organisierten Pädophilen oder Rechtsradikalen (sogar frühere SA-Mitglieder) ganz zu schweigen.
Es war unter dem Strich eine chaotische Melange aus allem, was der etablierte Politikbetrieb nicht integrieren konnte oder wollte. Treffend beschrieb es der Ur-GRÜNE und Dissident Milan Horacek später. „Von heute aus gesehen gab es anfangs viele Egozentriker, Spinner und Blödmänner in der Partei.“
Tatsächlich buhlten die GRÜNEN übrigens am Anfang auch sehr um enttäuschte SPD-Mitglieder, darunter auch Erhard Eppler. Doch die wollten mehrheitlich ihre Partie nicht verlassen. Um einen dauerhaften Dialog zwischen GRÜNEN und „grünen“ Sozialdemokraten zu etablieren wurde u.a. 1992 dann gemeinsam u.a. von Eppler, Kelly, Bastian, Gruhl, Böll und Grass die Deutsche Umweltstiftung gegründet, der ich heute als Vorsitzender vorstehe.
Wir haben in unsere Archiv zahlreiche spannende Originaldokumente und Protokolle aus dieser Zeit. Doch das wäre ein anderes, historisches, sicher sehr spannendes Thema.
Herzlichst, Jörg Sommer