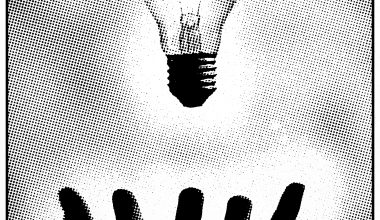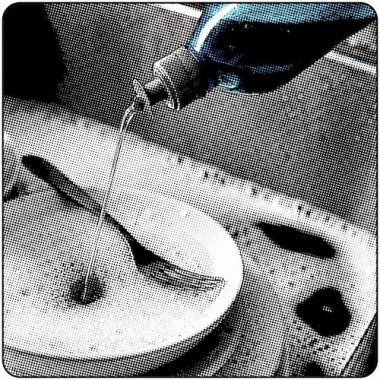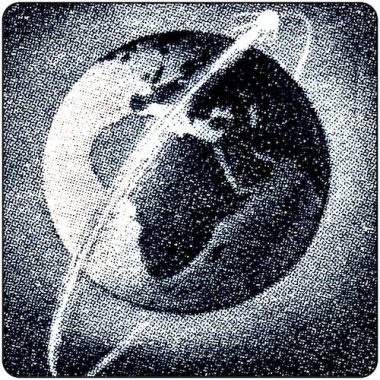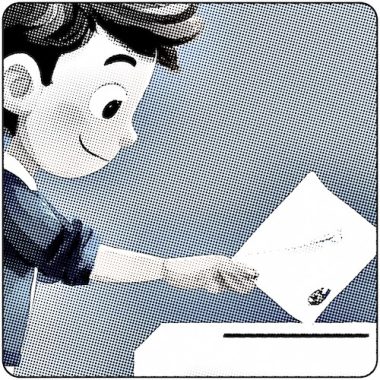Ausgabe #176 | 18. Mai 2023
Die Wut muss weg
Es beginnt mit einer Trennung.
Nach zehn gemeinsamen Jahren will sich Julie im Dezember 2018 von ihrer Partnerin Raphaëlle trennen.
Doch die dreht durch, stürzt dabei, bricht sich den Arm und landet in der Notaufnahme eines Pariser Krankenhauses.
Die ist völlig überlastet.
Die Mitarbeitenden schieben zum Teil seit einer Woche durchgehend Nachtschichten und protestieren gegen die unzumutbaren Arbeitsbedingungen.
Gleichzeitig eskalieren die Gelbwesten-Demos in der französischen Hauptstadt. Immer mehr Verletzte werden eingeliefert.
Die Krankenschwester Kim kümmert sich um viele von Ihnen. Mit einem gut lesbaren Aufnäher auf Ihrem Kittel:
En grève – im Streik.
So beginnt der von der Kritik hochgelobte Film „In den besten Händen“. Er ist Drama und Komödie zugleich. Und er dreht sich vor allem um ein Thema: Um Wut.
Alle in diesem Film werden von Wut getrieben. Sie lassen sie raus oder unterdrücken sie, sie leiden darunter. Oder fügen anderen Leid zu.
Wut treibt die die Konflikte voran – und sorgt zugleich dafür, dass sie nicht gelöst werden können.
Das ist nicht neu, nicht auf Frankreich beschränkt und auch nicht auf die Vergangenheit.
In Bremerhaven haben bei der Bürgerschaftswahl am vergangenen Sonntag mehr als 20 Prozent die „Bürger in Wut“ gewählt. Das waren mehr Stimmen, als die CDU für sich verbuchen konnte.
Es herrscht viel Wut in vielen Demokratien. Und diese Wut ist ein Treiber.
Es gibt diese Wut nicht erst seit gestern.
„Wutbürger“ wurde schon 2010 das Wort des Jahres. Und tatsächlich hat der starke Anstieg von Angeboten der Bürgerbeteiligung etwas mit dieser Entwicklung zu tun.
Dialogische Prozesse sollen mithelfen, die Wut zu dämpfen.
Das gelingt durchaus, aber bei weitem nicht immer.
Tatsächlich sind Beteiligungsformate sehr gut geeignet, um mit Wut umzugehen. Doch dafür müssen sie eines tun:
Wut zulassen.
Das ist schmerzhaft und deshalb wird es regelmäßig vermieden.
Beteiligungsprozess gelten allzu oft vor allem dann als gelungen, wenn sie maximal harmonisch verlaufen. Im Gegenzug kommen Moderator*innen und beauftrage Dienstleister schnell unter Druck, wenn’s „knallt“.
Das ist verständlich. Denn Konflikte bringen schlechte Presse, unangenehme Nachfragen aus der Politik, stören in Wahlkämpfen, führen zu Abwehrhaltungen bei Entscheiderinnen und Entscheidern.
„Die Wut muss weg,“ habe ich deshalb tatsächlich erst vor wenigen Wochen wieder von einem Oberbürgermeister gehört, „sonst macht Beteiligung keinen Sinn“.
Das ist eine fatale Einschätzung.
Weil Beteiligung sich mit realen oder möglichen Konflikten beschäftigt. Deshalb gibt es sie. Viele Konflikte in unserer Gesellschaft können eben nicht mehr „repräsentativ“ von wenigen für alle zufriedenstellend gelöst werden.
Deshalb setzt Beteiligung auf Dialoge.
Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Konflikte entemotionalisiert leichter bearbeitet werden können. Und das Beteiligende dies favorisieren.
Nachvollziehbar – aber unrealistisch.
Ähnlich wie der Apell in einem Beziehungskrach. Der Satz „Reg dich doch nicht so auf!“ hat genau wie oft funktioniert?
Eben.
Beteiligung behandelt Konflikte. Und das ist ohne Emotionen nicht zu haben.
Über Beteiligung als Format der Konfliktbearbeitung nachzudenken und dabei Konflikte als Problem zu betrachten, ist ein Ansatz, der schnell in die Irre führt.
Konflikte sind kein Problem für Beteiligung.
Konflikte sind ihre Grundlage.
Sie zu vermeiden, ist allerdings durchaus möglich.
Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten: manipulative Formate, Methoden oder Moderationstechniken. Ebenso wie die Versuchung, bestimmte Akteure gar nicht erst zu beteiligen.
Immer wieder hört man in jüngster Vergangenheit von einer vermeintlichen Stärke der zufallsbesetzten Bürgerräte (und anderer losbasierter Formate). Weil hier meist überwiegend Nichtbetroffene beteiligt werden, sind die Prozesse tatsächlich viel leichter und schmerzfreier umsetzbar – und die Ergebnisse ausgewogener.
Das macht dort Sinn, wo beteiligt wird, um Politik zu beraten.
Wo es um echte Konflikte mit echten (auch und gerade emotionalisierten) Betroffenen geht, braucht es auch eine Beteiligung eben jener Betroffenen.
Die bringen dann aber alles mit – auch ihre Wut.
Und das ist gut so.
Das macht die Prozesse nicht leichter, die Ergebnisse nicht automatisch besser. Aber es trägt zum gesellschaftlichen Frieden bei.
Wut geht nicht weg, indem man sie ignoriert, ausschließt oder wegmoderiert.
Wut wird im Dialog überwunden, aber nur im Dialog mit den Wütenden. Das gelingt nicht immer. Aber ohne Dialog gelingt es gar nicht.
Wenn also im nächsten Beteiligungsprozess keine Wut auf den Tisch kommt, dann heißt das nicht automatisch, dass wir alles richtig gemacht haben.
Wenn „Bürger in Wut“ mehr Stimmen auf sich vereinen als eine große Volkspartei, ganz zu schweigen von der bekannt hohen Zahl der wütenden Nichtwähler, dann sollten wir daraus vor allem eines lernen:
Die Wut muss nicht weg.
Sie muss zum Thema werden.