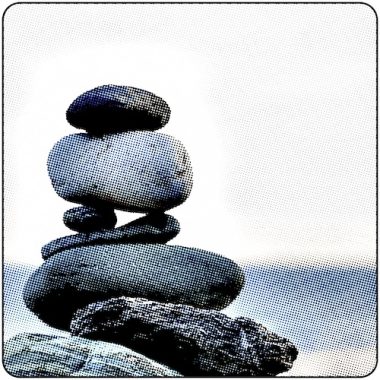Ausgabe #92 | 7. Oktober 2021
Geheimniskrämerei
Glaubt man den Legenden, so ist die potentielle Jamaika-Koalition nach der Bundestagswahl 2021 vor allem daran gescheitert, dass aus den ersten Sondierungsgesprächen zu viel nach außen drang. Während FDP und GRÜNE kein Wort über ihre Gespräche verloren, tauchten in der Presse immer dann Interna auf, wenn die CDU mit am Tisch saß.
Die öffentliche Empörung der beiden kleineren Parteien war groß.Man hatte den Eindruck: Für viele vom Volk gewählte Politiker*innen scheint es eines der schlimmsten denkbaren Verbrechen zu sein, wenn das Wahlvolk etwas von deren Verhandlungen hinter verschlossenen Türen erfährt.
Dabei geht es nicht um tatsächlich sicherheitsrelevante Themen wie Geheimdienstberichte oder Terrorabwehr. Sondern um die Frage, die nicht nur alle interessiert, sondern auch alle betrifft: Wer wird uns regieren? Und vor allem: zu welchem Preis?
Entsprechend sind auch nicht alle davon begeistert. Kritik an „Geheimverhandlungen“ artikulierten nicht nur einzelne Journalist*innen, sondern auch Mitglieder der verhandelnden Parteien. Sie forderten mehr Transparenz. Und damit sind wir bei einem der schwierigsten Themen in einer freiheitlichen Demokratie: Demokratie braucht Transparenz.
Sie ist die Voraussetzung für umfassende politische Teilhabe, die Grundlage jeder anspruchsvollen Partizipation. Umgekehrt ist Intransparenz und Geheimniskrämerei ein ganz wesentliches Merkmal diktatorischer Systeme. Denn wer gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung handelt, hat selbst kein Interesse daran, dass diese davon erfährt.
Dies ist einer der Gründe dafür, dass Intransparenz gerade in Gesellschaften mit demokratischem Anspruch so skeptisch beäugt wird. Der weit verbreitete Umkehrschluss lautet: Was geheim ist oder bleiben soll, dient nicht dem Gemeinwohl. Tatsächlich ist das naheliegend. Aber falsch.
Totale Transparenz wäre zwar spannend, aber gefährlich. Und zwar in allen Deliberationsprozessen. Denn da, wo verhandelt wird, muss es Bewegung geben. Sonst sind es keine Verhandlungen, sondern Positionsverkündungen.
Jede der beteiligten Gruppen hat eine eigene Community, egal ob Partei, NGO oder Bürgerinitiative. Immer sitzt die Mehrheit dieser Community nicht mit am Verhandlungstisch. Immer hat sie klare Positionen, oft von intentionellem Anspruch.
Die „reine Lehre“ wird sich in Verhandlungen am Ende nie durchsetzen. Es bedarf Verzicht, Kompromisse, Deals. Das gelingt nur Verhandlungspartner*innen, die sich aus der Deckung wagen, auf Gedankenspiele einlassen, die Interessen der anderen Seite verstehen und respektieren wollen.Am Ende brauchen alle Verhandlungsprozesse „geschützte Räume“. Dies gilt für Koalitionsverhandlungen genauso wie für Beteiligungsverfahren.
Die Tarifparteien in Deutschland verwenden dazu ein seit Jahrzehnten immer weiter ausgefeiltes System: Sie beginnen in großen Sälen mit 40- ja manchmal 60-köpfigen Tarifkommissionen. Dort werden Positionen verkündet und die Argumente der Gegenseite zerpflückt. Im Laufe der Tarifrunde werden die Gesprächsrunden dann immer kleiner und am Ende, gerne zu mitternächtlicher Stunde, sind es oft nur vier Personen, die den entscheidenden Durchbruch aushandeln. Das wesentliche Element dabei ist jedoch, die regelmäßige Rückkopplung der Verhandelnden mit ihren jeweils größeren Gremien – und am Ende sogar der Mitgliedschaft, die im Falle von Streiks letztlich über die Akzeptanz der Ergebnisse beschließen muss.
Gewerkschaften und Arbeitgeber*innen haben also gelernt, dass sich Phasen geschützter Räume immer wieder mit der Herstellung von Transparenz abwechseln müssen, um die Teilhabe der Betroffenen zu ermöglichen und Vertrauen zu generieren.
Genau so ist es auch in anderen gesellschaftlichen und politischen Strukturen: Verhandlungen brauchen geschützte Räume, Demokratie braucht Transparenz. Das ist ein Widerspruch, aber ein dialektischer. Man kann und muss ihn also leben.
Konkret heißt das in einer Demokratie: Es gilt das Prinzip der Rhythmischen Posttransparenz. Vertrauliche Verhandlungen finden statt, unterbrochen von Phasen, in denen über deren Verlauf und Zwischenstand Transparenz hergestellt wird.
Je länger der Prozess dauert, desto wichtiger ist dabei diese rhythmische Unterbrechung. Sie schafft Vertrauen in die Handelnden, Zuversicht über den Verlauf und Akzeptanz für das Ergebnis (oder ein Nichtergebnis).
Tatsächlich funktioniert die Rhythmische Posttransparenz auf allen Ebenen, von der Koalitionsverhandlung bis zur kommunalen Beteiligung zu konfliktträchtigen Themen.
Betrachten wir das aktuell in Berlin stattfindende Koalitionspoker, wird verständlich, warum die der CDU zugeschriebenen Indiskretionen ihre Verhandlungspartner so erboste. Die „geschützten Räume“ waren plötzlich ungeschützt. Und wir verstehen, warum der Konflikt die Menschen so irritiert: Die Rhythmische Posttransparenz beschränkte sich zu Beginn lediglich auf nichtssagende Sätze und Selfies in den Sozialen Medien.
Die Reaktion der Parteien – ihre Verhandler*innen auf ein Schweigekartell einzuschwören – ist verständlich. Und falsch. Es wird nicht funktionieren. Und das ist gut so.
Denn wer keine Transparenz herstellt, schafft kein Vertrauen. Wohl aber Versuchungen. Bleibt es dabei, werden wir in den kommenden Wochen beobachten, wer wann welcher Versuchung erliegt. Oder wir erleben einen Strategiewechsel hin zur Rhythmischen Posttransparenz. Denn ob in der großen Bundespolitik oder der konkreten Kommunalpolitik:
Geheimniskrämerei schafft stets mehr Probleme als Lösungen.