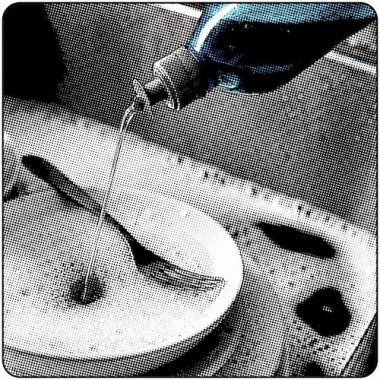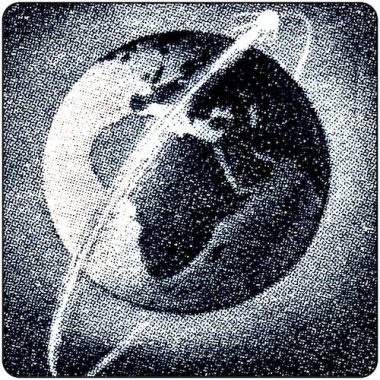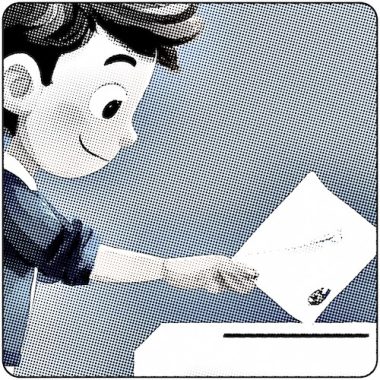Ausgabe #97 | 11. November 2021
Welche Wahl wir wählen
Nein. Die Überschrift ist kein Schreibfehler. Tatsächlich wollen wir heute darüber sprechen, was es mit unterschiedlichen Wahl- und Abstimmungsformen auf sich hat. Wie entscheidend ist also die Frage, wie in einer Demokratie entschieden wird?
Eine Partei wie die AfD will mehr Volksabstimmungen und direkte Demokratie in Deutschland, gerne nach Schweizer Vorbild. Ähnliches fordern auch andere Initiativen, die politisch sonst wenig mit den Rechtspopulist*innen verbindet.
Nach wie vor werden jedoch in Deutschland wie in den meisten Demokratien die Entscheidungen überwiegend von gewählten Institutionen getroffen. Diese repräsentativen Demokratien sind der Standard. Aber auch sie unterscheiden sich erheblich.
Die USA aber zum Beispiel auch Großbritannien sind von dem Prinzip der Mehrheitswahl geprägt. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, ist gewählt.
Anderswo gibt es Verhältniswahlen. In Deutschland haben wir auf Bundesebene mit Direktmandaten und Landeslisten eine eigene Version. In Frankreich wiederum kennen wir zweistufige Mehrheitswahlen.
In deutschen Kommunen kennen wir noch dazu je nach Bundesland ganz merkwürdige Dinge wie das Kumulieren und Panaschieren von Stimmen.
Neuerdings gewinnt bei Abstimmungen eine besonders innovative Methode immer mehr Anhänger*innen: das Systemische Konsensieren.
Es wird gerade auch in Beteiligungsprozessen immer wieder vorgeschlagen, manchmal auch offensiv eingefordert. Die im Rahmen der Corona-Leugner-Bewegung entstandene Partei „Die Basis“ hat sie sogar in der Satzung stehen.
Eigentlich schade.
Denn das Systematische Konsensieren ist alles andere als eine Spinnerei und durchaus eine Betrachtung wert:
Ziel dieses Verfahrens ist es, nicht die Lösung zu finden, für die sich die meisten aussprechen, sondern jene, die für möglichst viele tolerierbar ist. Das macht sie zum Beispiel für Prozesse der Bürgerbeteiligung interessant. Denn auch dort geht es ja häufig darum, eine Lösung zu finden, die den geringsten Widerstand und die wenigsten Frustrationen auslöst.
Das Mittel dazu: Jede/r Beteiligte wählt nicht eine Lösung, sondern vergibt Punkte für alle zur Auswahl stehenden Alternativen. Er kann in jedem Fall zwischen 0 und 10 Punkte vergeben. Die Pointe: Es sind so genannte Widerstandspunkte. Mit 10 Punkten bedenkt man also eine Lösung, mit der man absolut nicht leben kann. Findet man den Vorschlag nicht sehr prickelnd, könnte sich aber damit arrangieren, werden es vielleicht 5 Punkte sein. Und die eigenen Favoriten bekommen null Punkte.
Am Ende wird es der Vorschlag mit den wenigsten Punkten, also dem geringsten Widerstand.
Tastsächlich kann man so nicht nur Entscheidungen treffen, sondern sogar Parlamente wählen. Probieren Sie es ruhig einmal aus. Selbst die Programmentscheidung für den Familienfilmabend funktioniert so erstaunlich gut.
In Grundzügen entwickelt wurde die Methode schon in den 80er Jahren von Erich Visotschnig, einem IT-Projektmanager. Finalisiert erst Anfang dieses Jahrhunderts, populärer eigentlich erst in jüngster Vergangenheit.
Dennoch ist auch sie mit Vorsicht zu genießen. Denn eine durchaus berechtigte Kritik lautet: Sie lenkt den Fokus auf Ablehnung, nicht auf Zustimmung – und sie funktioniert in der Praxis nur gut, wenn es nicht zwei völlig antagonistische Fraktionen gibt.
Vor allem aber gilt: Am Ende ist auch das Systemische Konsensieren nur eine Methode, um ein Ergebnis festzustellen, eine Entscheidung zu treffen. Sie beendet einen Diskurs. Aber sie kann ihn nicht ersetzen.
Das gilt für alle Formen von Wahlen oder Abstimmungen: Sie haben immer einen finalen Anspruch. Sie fixieren Ergebnisse. Aber sie beenden nicht zwangsläufig auch Konflikte und ändern keine Einstellungen.
Dass es dabei eine solche Vielfalt an Formaten gibt, belegt letztlich vor allem eines: Die Wahl der Wahl, die Form der Abstimmung ist bei weitem nicht so wichtig für die Stärke einer Demokratie, wie oft vermutet.
Zusammenhalt entsteht nie durch eine Abstimmung. Er entsteht durch Diskurs, Debatte, Dialog. Und auch durch Streit.
Letztlich ist die spannende Frage für jede Demokratie und für jeden Teilhabeprozess also nicht: Wie entscheiden wir? Sondern: Wie streiten wir? Vor diesem Hintergrund ist auch das beste Abstimmungs- oder Wahlformat nicht hilfreich, wenn es zum falschen Zeitpunkt kommt – wenn es Diskurse vermeidet, statt fördert. Wenn es beenden soll, was noch gar nicht richtig angefangen hat.
Das gilt für die kleinen Themen ebenso wie für große gesamtgesellschaftliche Entscheidungen.
Diese Erkenntnisse hat uns übrigens auch die Diskussion um die „Bürgerräte“ beschert, die wir möglicherweise bald schon in Deutschland öfter erleben dürfen.
Das die deutsche Debatte prägende Vorbild dazu stammt ursprünglich aus Irland.
Es nannte sich dort „Citizens‘ Assembly“ und hatte genau die Aufgabe, eine gesellschaftliche Debatte im Vorfeld von Volksabstimmungen anzustoßen.
Eine kluge Initiative – die bei der deutschen Bürgerratsdebatte gerade etwas in den Hintergrund gerät. Hier werden die Bürgerräte manchmal eher als Form partizipativer Politikberatung verstanden. Das allerdings verschenkt ihr eigentliches Potential.
Denn wir haben ja gesehen: Es geht nicht um die Form der Entscheidungsfixierung, sondern um den möglichst breiten, intensiven Diskurs aller Beteiligten.
Das „D“ in Demokratie steht für Debatte. Immer. Egal, ob wir ein Bundesgesetz vorbereiten oder ein kommunales Radwegekonzept planen.
Das macht Demokratie so anstrengend. Und so schön.