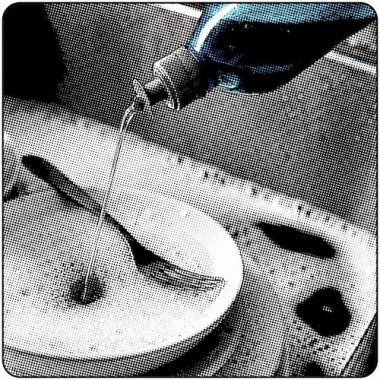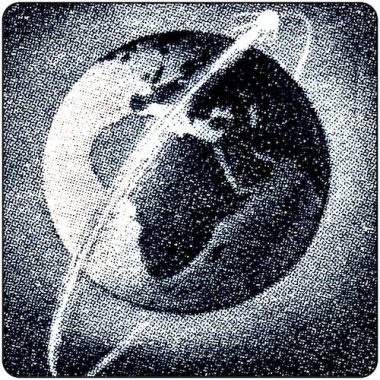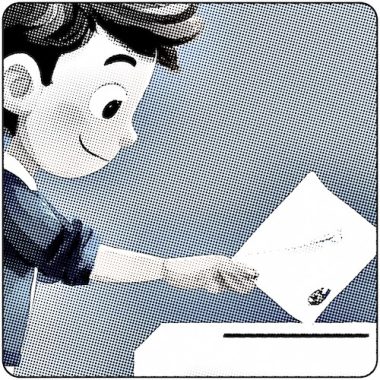Ausgabe #59 | 18. Februar 2021
Kein Grund zur Panik
Es ist etwas still geworden um Greta Thunberg. Sie erinnern sich? Das Mädchen, dessen ganz persönlicher Schulstreik gegen das Ignorieren des Klimawandels kaum jemand interessierte – bis daraus eine internationale Bewegung wurde, die Freitag für Freitag nicht mehr in die Schule, sondern auf die Straße ging. Das brachte ihr erhebliche (und wie immer kurzlebige) Aufmerksamkeit, die sie nutzte, unter anderem, um ihre berühmte Botschaft zu platzieren: „Ich will, dass ihr in Panik geratet“
Diese Worte sind alles andere als ein bockiger Ausruf einer renitenten 16-Jährigen. Tatsächlich zeugen sie von einer cleveren Analyse gesellschaftlichen Wandels. Warum? Weil die Geschichte des gesellschaftlichen Wandels seit Anbeginn der Zeiten immer wieder zeigt: Tiefgreifender Wandel findet dann statt, wenn es zu großen, nicht mehr aussitzbaren Konflikten kommt. So gut wie nie in der Geschichte gab es eine gemütliche, positive, schrittweise, sozialverträgliche, evolutionäre Entwicklung von mehr Wohlstand, mehr Teilhabe, mehr heiler Welt für alle. Veränderungen beruhten immer auf Konflikten und endeten häufig in einem kompletten Umsturz von gesellschaftlichen Strukturen, politischen Systemen, Nationen und Kontinenten.
„Panik“ als Auslöser eines globalen, tiefgreifenden Wandels hin zu einem klimagerechten Leben und Wirtschaften ist also durchaus eine Utopie, aber keine völlig absurde. Unter dem Strich ist sie weitaus realistischer als eine „Rettung der Welt“ durch kleine politische Nachjustierungen, neue Produkte, weniger Fleischkonsum, mehr Windräder und Elektroautos sowie Aktionen im Stil von „Wir pflanzen einen Baum für jeden neuen Versicherungsvertrag“.
Panik ist dabei sicher kein guter Ratgeber, sie beschreibt aber sehr treffend die Situation, in der große, fundamentale gesellschaftliche Veränderungen möglich werden.
Sie müssen dabei aber nicht automatisch immer zum Besseren sein. An einem Wandel unserer Demokratie arbeiten sich aktuell viele Kräfte ab, einige davon haben sehr autoritäre, rückwärtsgewandte Vorstellungen. Nicht alle schwenken eine Reichskriegsflagge, aber mit einer offenen, lebendigen Demokratie können viele von ihnen nichts anfangen.
Andere wiederum arbeiten an der Stärkung unserer Demokratie, engagieren sich für mehr politische Teilhabe, organisieren Beteiligungsangebote, erproben neue Formate – bis hin zum Deutschen Bundestag, der mit dem aktuell durchgeführten „Bürgerrat“ ganz neue Wege geht und so unsere repräsentativen Strukturen revitalisieren will.
Geboren sind diese Experimente und Prozesse nicht aus Panik, wohl aber aus der Erkenntnis, dass wir eine schleichende Destabilisierung unserer Demokratie erleben. Umwälzende gesellschaftliche Transformationen wurden und werden aus großen Konflikten geboren, doch „kleine“ Konflikte sind für echte, nachhaltige Reformen wichtig.
Das gilt tatsächlich auch für die Entwicklung der Bürgerbeteiligung in der vergangenen Dekade. Das Desaster um Stuttgart 21, als ein Bahnhofsneubau ein ganzes Bundesland zu spalten drohte, war so ein Impuls, der in Baden-Württemberg sogar mit Gisela Erler so etwas wie eine „Beteiligungsbeauftragte“ auf Kabinettsebene ermöglichte. Der festgefahrene Konflikt um ein atomares Endlager mit dem krachenden Scheitern des Standorts Gorleben führte zum Konzept einer neuen, weitgehend partizipativen Endlagersuche mit dem „Nationalen Begleitgremium“. Es war das erste Beteiligungsformat auf Bundesebene, das (teilweise) mit mehr oder weniger zufällig ausgewählten Bürger*innen arbeitet. Die Notwendigkeit, mehr Tempo in jahrzehntelange Planungsprozesse für Infrastrukturvorhaben (auch im Kampf gegen den Klimawandel) zu bringen, führte zu mehr, umfassender und früherer Beteiligung.
Das sind nur drei Konflikte, die bei allem Streit am Ende wichtige Impulse für mehr politische Teilhabe produzierten. Sie zeigen exemplarisch, dass wir unsere Demokratie weiter und breiter entwickeln können.
Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass Konflikte Treiber des Wandels sind. Wir haben die Wahl: Ignorieren wir sie, stauen sie sich irgendwann auf und haben letztlich das Potential, eine ganze Gesellschaft zu zerlegen. Nehmen wir sie an, helfen sie uns dabei, unsere Demokratie zu stärken, indem wir sie verändern. Diese Anpassung mag hin und wieder schmerzhaft sein, glatt verläuft sie nie. Aber wie sagen erfolgreiche Sportler*innen: „Es sind die kleinen Schmerzen, die dich weiterbringen.“
Übrigens gilt all dies auch für die „kleinen“ Prozesse vor Ort, in unseren Kommunen und anderswo: Konflikte sind nie das Problem. Es ist der Umgang mit ihnen.
Verstehen wir sie als Impulse für mehr Diskurs und Beteiligung, machen sie uns stark. Ignorieren wir sie oder sehen sie als „Störung“ unserer eingefahrenen Gemütlichkeit, dann wird irgendwann kein Diskurs mehr möglich sein, sondern nur noch Disruption.
Im Grunde sind solche Konflikte also nie ein Grund zur Panik. Eher zur Freude. Denn was aus ihnen wird, hängt allein von uns ab: Sehen wir sie als Chancen, sind sie welche. Sehen wir sie als Bedrohung, werden sie auch dazu.
Alles in allem: Es gibt viele Gründe, mehr Teilhabe zu organisieren – aber keinen Grund zur Panik.