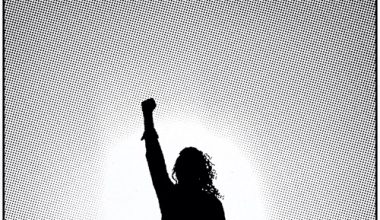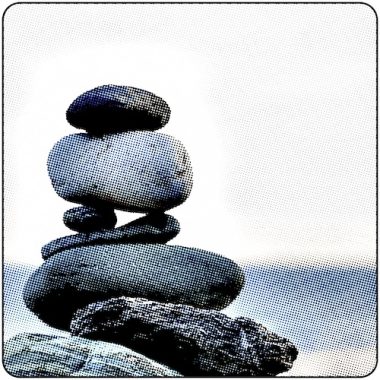Ausgabe #56 | 28. Januar 2021
Wer repräsentiert wen?
Was haben eine 22-jährige begabte Jurastudentin aus Bayreuth, die für einen Bürgerrat ausgelost wurde und ein 58-jähriger Ex-Strafrichter und aktueller AfD-Bundestagsabgeordneter aus Wiesbaden gemeinsam?
Beide sind „Repräsentanten“.
Und da sind wir auch schon beim Missverständnis.
Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Darüber besteht Konsens. Doch was heißt das genau? Politische Wörterbücher, Wikipedia und ähnliche Quellen mehr oder weniger verlässlichen Wissens erläutern uns dies in etwa so:
In einer repräsentativen Demokratie werden politische Entscheidungen im Gegensatz zur direkten Demokratie nicht unmittelbar durch das Volk selbst, sondern durch Abgeordnete getroffen. Die vom Volk gewählten Volksvertreter – und nur sie – repräsentieren das Volk.
In der Theorie.
Denn „das Volk“ ist in diesem Fall ein ziemlich optimistischer Begriff. Im Bundestag zum Beispiel sitzen nur zur Hälfte Abgeordnete, die tatsächlich persönlich gewählt wurden. Und auch dann nur in ihrem Wahlkreis, von Wahlberechtigten, die zur Wahl gingen und ihnen tatsächlich ihre Stimme gaben.
Das ist am Ende ein sehr kleiner Anteil „des Volkes“.
Die andere Hälfte verdankt ihr Mandat einem Platz auf der Landesliste ihrer Partei, also den Stimmen einer maximal dreistelligen Zahl von Delegierten. Auch hier war an der Auswahl nicht viel Volk beteiligt.
Das delegitimiert bei weitem nicht die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages, denn eine solche mittelbare Demokratie hat viele Vorteile, einer davon ist die starke Resilienz gegen kurzfristige Stimmungsschwankungen in der Bevölkerung. Insbesondere in Krisenzeiten sind oft unpopuläre Entscheidungen nötig, wie uns die aktuelle Corona-Pandemie Woche für Woche drastisch vor Augen führt.
Man kann trefflich darüber streiten, ob eine solche repräsentative Demokratie die beste aller denkbaren Demokratien ist und derartig legitimierte „Repräsentanten“ tatsächlich die jeweils beste Lösung für alle Herausforderungen der Politik aushandeln können.
Konzentrieren wir uns fürs erste jedoch darauf, was „Repräsentant“ in diesem Kontext ausschließlich meint: Eine Repräsentationsfunktion als „Vertreter kraft Wahl“. Das ist, egal wie konstruiert, am Ende die stärkste demokratische Legitimation überhaupt.
Jetzt kommen wir zu einer der unendlich vielen Unschärfen der deutschen Sprache, die immer wieder auch zu einem unscharfen Denken und zu spannenden Missverständnissen führt: Als repräsentativ verstehen wir nämlich im Alltagssprachgebrauch nicht wirklich „durch Wahl legitimiert“, sondern eher so etwas wie „hat die gleichen biologischen, sozialen, religiösen, … Eigenschaften“.
Bleiben wir beim Bundestag, stellen wir schnell fest, dass da im Verhältnis zur Bevölkerung bestimmte Eigenschaften deutlich überwiegen.
Es gibt im Parlament viele Juristen, viele Ältere, viele Akademiker und eine ganze Menge Männer. Deshalb hören wir immer wieder Frauen, Jüngere, Migrant*innen, Arbeiter*innen seien „unterrepräsentiert“. Das stimmt.
Und doch stimmt es nicht.
Es besteht kein Zweifel daran, dass sich im Politikbetrieb die Interessen bestimmter Akteure immer wieder leichter und erfolgreicher durchsetzen.
Die Prozesse und Strukturen, die das bewirken, sind komplex. Sie haben etwas mit Parteipolitik zu tun, mit Lobbyismus, mit Ressourcen, die investiert oder in Aussicht gestellt werden, mit kulturellen Kompetenzen, mit Macht, Ethik, manchmal schlicht mit Sympathien oder Antipathien und manchmal auch mit krimineller Energie. Vieles könnte besser laufen, manches läuft richtig schlecht und manche Teile unserer Bevölkerung haben tatsächlich kaum eine Lobby.
Auch ich gehöre zu den Menschen, die glauben, dass mehr Frauen im Bundestag der Politik gut tun würden, und doch sollten wir uns vor einer großen Gefahr hüten: Zu glauben, dass das repräsentativ in „repräsentative Demokratie“ für irgendeine Art von sozialem, religiösem, ökonomischem, biologischem oder gar rassischem Proporz stehe.
Die Legitimation für demokratisch gewählte Politiker entsteht durch ihre Wahl und nicht durch ihre Gene, ihren Glauben oder ihre Einkommensklasse.
Dass das zu Verwerfungen von Interessensvertretung führen kann, erleben wir Tag für Tag. Das zu regulieren, bleibt eine stetige Herausforderung einer demokratischen Gesellschaft.
Die optimale Antwort darauf ist noch nicht gefunden. Quotierung kann ein Hebel sein. Mehr direktdemokratische Entscheidungen in Grundsatzfragen ist ein weiterer, Beteiligungsangebote für die breite Bevölkerung ist ebenfalls einer, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Doch da aus nachvollziehbaren Gründen nicht zu allen Themen alle beteiligt werden können (obgleich es da, gerade in der digitalen Welt, noch ganz schön viel Luft nach oben gibt), ist auch hier oft nur ein minimaler Anteil der Betroffenen involviert.
Kommunal klappt das oft über die Selbstselektion. Wer will, macht mit. Im Ergebnis machen natürlich oft überproportional viele Menschen aus Milieus mit, die bereits in den Parlamenten „überrepräsentiert“ sind.
Eine in letzter Zeit deshalb immer beliebtere Form der Rekrutierung ist die „Zufallsauswahl“, also ein irgendwie losbasiertes Verfahren.
Das ist nicht ohne Tücken, denn erfahrungsgemäß hat die übergroße Zahl der „Ausgelosten“ oft so gar kein Interesse daran, mitzuwirken.
Lost man also 1.000 Bürger*innen aus, ist die Chance groß, am Ende maximal 100 Beteiligte zu haben. Da diese sich also faktisch doch wieder aus den 1.000 „Auserwählten“ selbst rekrutieren, ist es nicht verwunderlich, dass auch so wieder die mehrfach erwähnten Milieus einen größeren Anteil haben als in der Gesamtbevölkerung.
Auch dieses Problem ist nicht unerkannt. Deshalb ist das Losverfahren oft nur ein Teil des Auswahlprozesses, meist, nicht immer, am Anfang. Danach wird gewichtet und umgeschichtet bis ein Panel steht, in dem irgendwie die Quoten an Geschlechtern, Bildungsgraden, Altersgruppen, Religionszugehörigkeiten denen der Gesamtbevölkerung nahe kommen.
In den Medien schlägt sich das dann gerne in kuriose Formulierungen nieder. Zitate wie „ein zufällig ausgelostes, repräsentatives Gremium…“ zaubern mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht.
An diesem Satz stimmt gar nichts.
Unsere Demokratie benötigt nicht mehr „Gremien“, sondern mehr Diskurse. Dafür ist Beteiligung da. Die Teilnehmer*innenschaft ist nicht zufällig ausgelost. Und repräsentativ ist sie auch nicht.
Denken wir noch einmal kurz an unsere eingangs vorgestellte Jurastudentin. Wen repräsentiert sie? Wessen Meinung bringt sie ein? Für wen spricht sie? Für alle Studenten? Für alle Frauen? Für die Juristen? Die Veganer? Die Bayern? Und wir kennen noch nicht einmal ihre Gene, ihren Glauben und ihre sexuellen Vorlieben. Das müssen wir auch nicht. Wir müssen nur eines realisieren:
Sie ist repräsentativ für niemanden.
Sie spricht für niemanden. Sie spricht für sich. Ihre Aufgabe ist es nicht, irgendjemanden oder irgendwas zu „repräsentieren“. Dazu legitimiert sie auch nichts, weder der Zufall, noch die Auswahl durch die beteiligende Institution, noch eine demokratische Wahl.
Und das ist auch nicht das Konzept von Beteiligung. Beteiligung beteiligt Menschen, nicht Repräsentanten.
Eben das ist ihre Stärke.
Viele sprechen von einer „Krise der repräsentativen Demokratie“. Dafür gibt es gute Gründe. Und es gibt viele Möglichkeiten, dem entgegenzusteuern. Dazu gehören mehr direkte Diskurse, auch mehr politische Debatten, wohl auch mehr wertschätzenden Streit, sicher mehr Beteiligung.
Was wir nicht brauchen, sind noch mehr „Repräsentanten“.
Wir brauchen mehr Beteiligte. Viel mehr. Viel öfter. Viel umfassender. Und ja, auch und gerade aus den „unterrepräsentierten“ Gruppen. Doch die Lösung dafür heißt nicht „repräsentative Beteiligung“, sondern „breite Beteiligung“. Das erfordert andere Prozesse und andere Rekrutierungsmethoden. Welche, das schauen wir uns in den kommenden Wochen genauer an.