Ausgabe #118 | 7. April 2022
Das muss man sich verdienen
Im Grunde beginnt die Leidensgeschichte für Juan „Johnny“ Rico und die meisten seiner Kameraden aus einem manchem banal erscheinenden Grund: Sie wollen wählen. Und das Recht in Anspruch nehmen, gewählt zu werden.
Für viele von ihnen kommt es jedoch nie dazu – sie hauchen ihr Leben auf hunderte unschöne Arten aus. Auf fremden Planeten, im Kampf gegen die „Bugs“ – intelligente, insektenähnliche Wesen, mit denen die Menschheit im immerwährenden Kampf steht.
Robert Heinlein schrieb den in Teilen bemerkenswert aktuell erscheinenden Roman Starship Troopers in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Bis heute gilt er als Meilenstein des Science-Fiction-Genres.
Im Roman wurde die Irrlehre der „Massendemokratie“ lange überwunden. Stabilität sichert vor allem ein Prinzip: Das aktive und passive Wahlrecht erlangt nur, wer es sich zuvor als Soldat verdient hat.
So bleibt das System stabil – und der Kriegsdienst attraktiv.
Tatsächlich ist die Idee, dass demokratische Rechte erst verdient werden müssen, ebenso alt wie die Demokratie selbst. Und sie hat in deren Geschichte ganz unterschiedliche Rollen gespielt.
Als im damaligen Preußen das Dreiklassenwahlrecht eingeführt wurde, war dies eine unmittelbare Reaktion auf die bürgerliche Revolution von 1848. Es galt als ungeheuer progressiv, wurde von Konservativen zunächst entschieden abgelehnt – als „verwerfliche Gleichmacherei“.
Zum einen, weil damit erstmals ein allgemeines Wahlrecht eingeführt wurde und jeder (Mann über 24 Jahren) wählen durfte. Zum anderen, weil die Wertigkeit der Stimme nach der gezahlten Steuer bemessen wurde, also nach jener Leistung, die der Einzelne gegenüber dem Staat erbrachte.
Zuvor war politischer Einfluss vor allem an Abstammung und Grundbesitz gekoppelt.
Die Grundidee, demokratische Rechte von einer Leistung für die Gesellschaft abhängig zu machen, war also zunächst einmal progressiv. Letztlich führte sie jedoch dazu, dass die konservativen Kräfte in den Parlamenten deutlich überrepräsentiert waren. Zum Ende dieser Periode erhielt zum Beispiel die SPD im Jahr 1913 trotz 30 Prozent der Wählerstimmen gerade einmal 2,3 Prozent der Sitze im Parlament.
Das änderte sich erst mit der Novemberrevolution von 1918. In deren Verlauf rief der Rat der Volksbeauftragten das allgemeine demokratische Wahlrecht aus. Damit wurde das Dreiklassenwahlrecht in Preußen abgeschafft und gleichzeitig in ganz Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt.
Allerdings hat sich der Gedanke, dass demokratische Rechte nicht per se für alle gleichermaßen gelten, sondern an eine Gegenleistung geknüpft sind, unterschwellig bis heute gehalten.
Gerade in dieser Woche werden wir daran erinnert: In Baden-Württemberg wurde die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre beschlossen.
Damit wird nicht nur das Mindestalter für das aktive Wahlrecht für Landtagswahlen, sondern auch für Volksabstimmungen, -anträge und -begehren um zwei Jahre abgesenkt.
Gegner*innen argumentierten einerseits mit „mangelnder geistiger Reife“, andererseits aber auch damit, dass Jugendliche in diesem Alter noch nicht wirklich etwas für die Gesellschaft geleistet hätten.
Da ist sie also wieder: die Idee, dass Wahlrecht kein Menschenrecht, sondern ein Verdienst sei.
Ein anderes Beispiel: In der Europäischen Union dürfen alle EU-Bürger*innen an den Kommunalwahlen ihres Hauptwohnsitzes teilnehmen, unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat er sich befindet.
Auch hiergegen gab und gibt es noch immer Widerstände. Und dass, obwohl dieses Recht nur für die Kommune, nicht aber für überregionale und nationale Wahlen gilt – und auch nur für Ausländer*innen mit einem EU-Pass.
Geflüchtete, Migrant*innen, selbst hier dauerhaft lebende, hochbezahlte ausländische Fachkräfte haben kein Wahlrecht. In vielen Städten Deutschlands sind so letztlich bis heute nur rund 60 Prozent der Einwohner*innen wahlberechtigt. Annähernd die Hälfte der Menschen, die politische Belange betreffen, dürfen nicht wählen.
Doch wer nicht wählen darf, darf doch immerhin seine Meinung sagen?
Darf er (oder sie). Doch zugleich erleben wir natürlich in vielen Debatten immer wieder Ungleichgewichte. Oft subtil, weil „verdienten“ Mitgliedern, Mandatsträger*innen, Bürger*innen eher zugehört und geglaubt wird. Manchmal explizit, wenn es heißt: „Was will der junge Schnösel, der soll erstmal was leisten“. Ganz besonders explizit wird das in den Sozialen Medien, wenn es um die Schulstreiks der Fridays-for-Future-Bewegung geht. Da prasseln die „Leistungsargumente“ im Sekundentakt auf die jungen Menschen nieder.
Ein freiwilliger oder eingeforderter Respekt vor der Lebensleistung zumeist älterer und /oder erfolgreicher Menschen ist ebenso verständlich wie begründbar. Er ist aber – und darum geht es in diesem Zusammenhang – in demokratischen Prozessen kritisch zu betrachten. Denn das Wesen von Demokratie ist Diskurs. Das Wesen von Diskurs ist aber der Austausch von Argumenten. Und da ist Respekt fehl am Platz.
Jede*r hat nicht nur ein Recht darauf, gehört zu werden, sondern auch darauf, dass seine oder ihre Argumente auch erwogen werden. In demokratischen Diskursen – und das heißt zum Beispiel auch in allen Formen von Beteiligungsprozessen, darf es nicht um Alter, Orden, Einkommen, Bildung, Geschlecht, Religion, Sprachkompetenz oder ausstellende Passbehörde gehen.
Und das nicht nur aus Gründen der Gleichberechtigung, sondern auch aus Gründen der Qualität. Denn nicht immer sind die Argumente der „Verdienten“ die besseren.
Und es gibt noch einen dritten Grund, aus dem wir gut beraten sind, Verdienst und Argument zu trennen: Das Dreiklassenwahlrecht hat, wie wir gesehen haben, konservative Parteien bevorzugt und damit Wandel gebremst. Dieser Effekt tritt immer dann auf, wenn „Verdienste“ mehr Einfluss bedeuten.
Denn diese Verdienste werden naturgemäß von jenen erworben, die länger im bisherigen System erfolgreich und daher anerkannter waren. Also von Profiteur*innen des Ist-Zustandes. Je mehr wir Einfluss und Verdienst trennen, desto größer ist das Potential von Wandel.
Und genau darum geht es in einer Demokratie, das macht sie stark: die Organisation von klugem, reflektiertem und diskutierten Wandel. Diktaturen setzen auf Bestand, Demokratien sind genau jene Gesellschaftsform, die Wandel ermöglicht – aber auch benötigt.
Das gilt im Großen. Deshalb ist die Entscheidung in Baden-Württemberg nicht der Untergang der Demokratie, sondern im Gegenteil: ein Anfang. Das gilt aber auch im Kleinen für jeden Beteiligungsprozess: Er soll gesellschaftlich verträglichen Wandel ermöglichen. Das heißt in der Folge: Er muss alle beteiligten, eben nicht nur die „Verdienten“ und „Starken“, sondern auch jene, die nicht zu den „Leistungsträger*innen“ gehören. Doch das ist erst die halbe Miete.
Er muss auch so organisiert werden, dass alle dieselben Wirksamkeitsmöglichkeiten haben. Das ist anspruchsvoll und eine ständige Herausforderung an Methoden und Moderation.
Und es kann manchmal auch bedeuten, ein „umgekehrtes Drei-Klassen-System“ zu denken, nämlich die Jungen, Migrant*innen und weniger durchsetzungsfähigen Gruppen gezielt überrepräsentativ zu beteiligen. Das erhöht die Bereitschaft, sich aktiv einzubringen erfahrungsgemäß ganz erheblich.
Letztlich geht es darum, auf die Stärke der Demokratie zu setzen: Sie ist die bislang einzige große Gesellschaftskonzeption, die Wandel organisieren kann.
Und wir leben in einer Zeit, die von Wandel geprägt ist. Klimaschutz und globale Krisen fordern tiefgreifende Veränderungen in der Art, wie wir leben und arbeiten. Diese große Transformation hat einen offenen Ausgang. Ihn maximal solidarisch und gemeinwohlorientiert verhandeln, kann nur die Demokratie. Dabei braucht sie jede*n und alle.
Den Grad der Mitwirkung an irgendwelche ökonomischen Verdienste, genetische Zufälle oder genossene Bildungsprivilegien zu knüpfen, ist weder klug noch richtig.
Ich selbst hatte die Ehre, im vergangenen Juni von unserem Bundespräsidenten mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet zu werden. Ob es verdient war? Ich bin mir nicht sicher. Was ich aber sicher weiß: Dadurch ist kein einziger meiner Sätze klüger geworden, kein einziges meiner Argumente besser. Es bleibt also eine Erkenntnis: Demokratische Mitwirkung darf nicht an Verdienst gekoppelt sein. Die Logik ist eine andere: Demokratie müssen wir uns verdienen. Wir alle, gemeinsam, immer wieder neu.
Und wir sind gut beraten, uns dabei richtig anzustrengen.



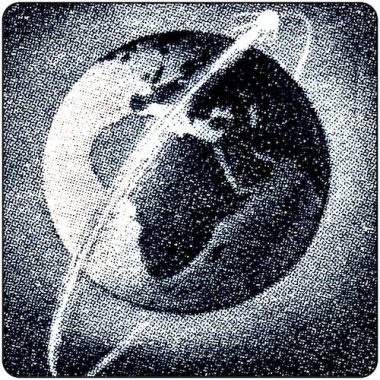


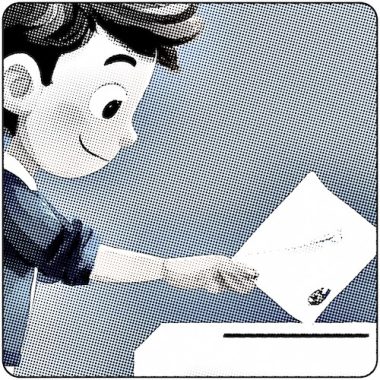


Bemerkenswertes Zitat:
Im Roman wurde die Irrlehre der „Massendemokratie“ lange überwunden.
Wie weit sind wir damit im realen Verständnis von Demokratie? Zählen nicht immer noch, immer wieder und weiter die Massen? Egal auf welchem Wege sie sich zuhauf gefunden haben? Wenn Poltiker im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit eingeblendetem Namen und groß geschriebener Funktion solche Sätze absondern: „Der Krieg digitalisiert sich. Er wird moderner und da müssen wir mithalten!“ Dann ist das sicherlich eine Vorgabe, die Besitzer von Rüstungsaktien ebenso begeistert wie Programmierer und KI- Verdiener. Und das ohne die eigene Verantwortung für Kriege zu reflektieren.
Soll diese „Demokratie“ tatsächlich Wandlungsfähigkeit besitzen?