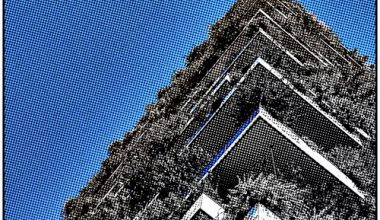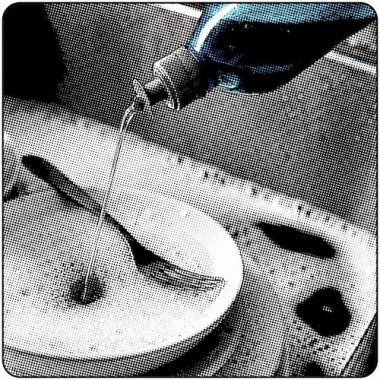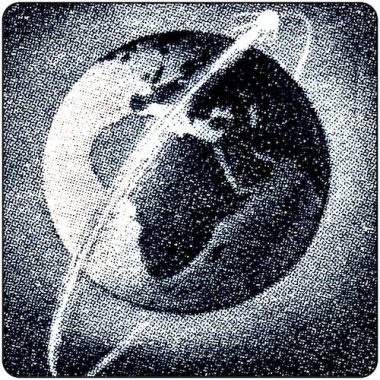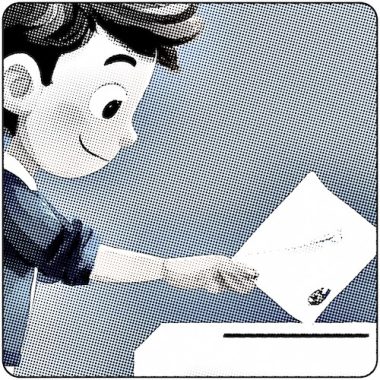Ausgabe #87 | 2. September 2021
Wandel von unten?
Sie ist alternativlos: Die Transformation zur Nachhaltigkeit, zu einer Gesellschaft, die den Klimaschutz und die Ökosystemverträglichkeit ebenso als Leitmotiv akzeptiert wie die Gerechtigkeit – auch gegenüber kommenden Generationen.
Das haben wir in der vergangenen Woche diskutiert und ebenso die Frage, wie diese Transformation in einer demokratischen Gesellschaft funktionieren kann.
Wir haben gesehen, dass wir keine Ökodiktatur brauchen, dass wir aber auch in einer Demokratie keine Chance haben, diese Transformation von oben nach dem Top-down-Prinzip durchzupeitschen.
Denken wir die Prozesse doch einfach einmal komplett andersherum.
Eine Idee, die nicht erst seit dem Wachsen der Fridays4Futures Bewegung an Attraktivität gewonnen hat. Tatsächlich ist es so, dass eine Transformation nur als gemeinsamer Prozess denkbar ist.
Da scheint die Forderung nach mehr direktdemokratischen Entscheidungsmöglichkeiten nur logisch zu sein.
In der Tat bergen plebiszitäre Strukturen wichtige Potenziale. So erhoffen sich Befürworter*innen vor allem eine schnellere und effizientere Entscheidungsfindung in dringlichen Nachhaltigkeitsfragen.
Umweltgesetze stehen zwar oft oben auf der politischen Agenda, werden aber meist schleppend oder unvollständig verabschiedet. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der Umweltschutz mit Wirtschaftsinteressen kollidiert und im Zweifelsfall häufig das Nachsehen hat.
In den meisten Fällen bestimmt die Wirtschaftslobby das Gesetzgebungsverfahren stärker als die Stimmen kleiner Naturanwält*innen.
Der Erfolg des Bienen-Volksbegehrens in Bayern unterstreicht diesen Ansatz exemplarisch. Befürworter*innen direktdemokratischer Verfahren gehen davon aus, dass dem/r Bürger*in Umweltfragen mehr am Herzen liegen als die Aufrechterhaltung der Privilegien einzelner Wirtschaftszweige.
Hinzu kommt, dass direktdemokratische Verfahren bildungspolitische Effekte haben können. Die repräsentative Demokratie scheitert daran, einen nachhaltigen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Demgegenüber müssten sich die Bürger*innen in einem plebiszitären System aktiv mit umweltpolitischen Sachfragen beschäftigen.
Im Idealfall entwickeln aktive Bürger*innen in diesem System ein tieferes Verständnis für die Ziele ökologischer Nachhaltigkeit. Damit könnten sie den Grundstein für den längst überfälligen gesellschaftlichen Kulturwandel legen.
Doch auch der Bottom-up-Ansatz birgt Risiken. So nützt die direkte Demokratie der Umwelt nur dann, wenn die teilnehmenden Akteur*innen auch mehrheitlich tatsächlich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele verfolgen.
Vor allem für ökologische Ziele ist die Motivation der Menschen jedoch weitaus weniger optimistisch einzuschätzen, als zuweilen angenommen.
Zwar gibt es regelmäßig bei Umfragen hohe Zustimmungswerte für Forderungen nach mehr Umwelt- und Klimaschutz. Geht es jedoch an den eigenen Geldbeutel oder die eigene Bequemlichkeit, wird daraus schnell Ablehnung. Noch immer geht der Trend zum fossil angetriebenen SUV statt zum kleineren Elektroauto, noch immer tendiert die Bereitschaft zum Konsumverzicht oder Kauf des teureren ökologischeren Produkts gegen null.
Diese Lücke zwischen Erkenntnis und Verhaltensänderung ist dramatisch.
Zu glauben, ein Volk von Konsument*innen, SUV-Fahrer*innen und Billigfleischesser*innen würde seine plötzlich verfügbaren direktdemokratischen Optionen dazu nutzen, diesen Lebenswandel abzuschaffen, ist kaum realistisch.
Im Gegenteil: Die Gefahr, dass bei zunehmenden Belastungen populistische Mehrheiten zustande kommen, ist groß. Es gibt Gründe dafür, dass ausgerechnet die AfD am lautesten direkte Demokratie fordert und gleichzeitig den menschengemachten Klimawandel leugnet.
Ohnehin lassen sich hochkomplexe Umweltfragen und der nötige grundlegende Kulturwandel nicht durch einfache „Ja-Nein“-Entscheidungen beantworten. Sie verlangen Abwägungsprozesse und Dialoge.
Dass sich die direkte Demokratie jedoch nicht sonderlich gut für Kompromisse und Mediation eignet, hat Giovanni Sartori mit seiner historischen Analyse der Stadtstaaten (Polis) im antiken Griechenland bereits gezeigt. Die dort vorherrschende „Tyrannei der Mehrheit“ (1987) kannte (zumindest in gewissen Perioden) nur Sieg oder Niederlage.
Es lässt sich also festhalten, dass auch der Bottom-up-Ansatz der unmittelbaren Volksherrschaft nicht der Königsweg für eine ökologisch-nachhaltige Transformation ist.
Transformation ist weder ausschließlich ein Top-down- noch ein Bottom-up-Prozess. Sie verlangt allen viel ab. Und sie benötigt einen kollektiven Bewusstseins- und Kulturwandel.
Es bedarf folglich eines anderen Ansatzes. Welcher das sein kann, das untersuchen wir in der kommenden Woche, wenn wir unseren kleinen Dreiteiler zu „Transformation und Partizipation“ gemeinsam abschließen.