Ausgabe #162 | 9. Februar 2023
Angebote oder Aussichten?
Wilhelm Voigt war frisch „resozialisiert“. Kürzlich aus der königlich-preußischen Vollzugsanstalt entlassen, wollte er sich in die Gesellschaft integrieren.
Dazu brauchte er Arbeit.
Doch die gab es nicht ohne eine amtliche Aufenthaltserlaubnis. Die wiederum gab es nicht ohne Arbeitsplatz.
Also entscheidet sich Voigt, das Land zu verlassen. Doch das geht nicht ohne einen Pass. Den aber wiederum gibt es nicht ohne …
Sie kennen die Geschichte vom „Hauptmann von Köpenick“? Vor fast 100 Jahren schrieb Carl Zuckmayer das Buch, basierend auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1906.
Seitdem kennen wir das Köpenick-Syndrom: Das eine geht nicht ohne das andere, das nicht ohne das eine geht.
Und wir kennen, nicht nur aus Zuckmayers Buch, das gesellschaftliche Problem: Gehört man einmal zu einer stigmatisierten Gruppe, hier die Ex-Sträflinge, dann wird man auch entsprechend betrachtet und behandelt.
Auch in der modernen Gesellschaft teilen wir Menschen in Gruppen ein. Weil es durchaus Sinn macht.
Doch zugleich sind wir auch sensibel geworden, was solche Einteilungen angeht. Stigmatisierung, ja sogar der Verdacht von Rassismus, ist oft nur einen Schritt, einen Begriff entfernt.
Deshalb arbeiten wir heute oft mit Gruppenzuschreibungen, die wir lange kennen, nennen sie aber anders. „Ausländer*innen“ sind heute „Menschen mit Migrationshintergrund“, Ungebildete sind „bildungsferne Gruppen“. Der Mechanismus der gruppenbezogenen Zuschreibung – und oft auch die Folgen davon, sind nach wie vor dieselben.
Wenn wir also heute von „beteiligungsfernen Gruppen“ sprechen, dann sollten wir uns nicht vom Euphemismus blenden lassen: Diese Gruppe ist nicht homogen. Dazu können Menschen gehören, die nicht „beteiligungsfern“ sind, sondern die Demokratie bewusst ablehnen.
Debatten mit Reichsbürger*innen und Autokratiefans zu führen, ist daher wichtig, aber eine ganz andere Aufgabe als jene zu erreichen, die nur deshalb „beteiligungsfern“ sind, weil man ihnen bislang kein überzeugendes Angebot unterbreitet hat.
Junge Menschen werden oft zur Gruppe der „Beteiligungsfernen“ gezählt, ebenso auch Ältere sowie „bildungsferne“ Menschen „mit und ohne Migrationshintergrund“.
Wir betrachten heute einmal die jungen Menschen genauer. Die damit verbundenen Überlegungen gelten in Teilen auch für die anderen erwähnten Gruppen. In überraschend großen Teilen.
Tatsächlich gelten sie größtenteils für alle. Denn je intensiver wir uns mit der „Beteiligungsferne“ beschäftigen, desto klarer wird eine Erkenntnis:
Es sind weniger die Menschen, die der Beteiligung fern sind, sondern es sind oftmals die Teilhabeangebote, die den Menschen fern sind.
Also nähern wir uns dieser Gruppe einmal von der Beteiligung her.
Sich zu beteiligen ist anstrengend. Es kostet Zeit. Und Nerven. Es fordert Kommunikation mit anderen Menschen ein, oft auch mit andersdenkenden Menschen. Es fordert geistige Anstrengung ein, die Bereitschaft, Informationen zu verarbeiten. Kritisiert zu werden. Unangenehme Situationen zu bestehen, sich unverstanden zu fühlen, manchmal sogar dumm.
Junge Menschen können all das in der Schule haben. Ob sie es wollen oder nicht. Tag für Tag. Jahr für Jahr.
Wenn sie es durchstehen, winkt ihnen dafür die ferne Aussicht auf beruflichen Erfolg, attraktives Einkommen, finanzielle Sicherheit. Wie motivierend diese Aussicht ist, wie gut das Konzept funktioniert, erleben wir Tag für Tag an Deutschlands Schulen.
Dieses System funktioniert in weiten Teilen nur aus einem Grund: Weil die Beteiligten nicht wirklich eine Wahl haben.
Dort wo sie die Wahl haben, setzen sie sich ähnlichen Zumutungen in der Regel nicht aus. Es sollte uns nicht wundern.
Einige wenige tun es doch. Der Grund ist meist derselbe. Für sie persönlich stellen diese Zumutungen weniger Belastung und mehr potentiellen Gegenwert dar. Die Bilanz ist für sie ausgeglichener.
Und das liegt an beiden Seiten der Gleichung, wenn auch individuell höchst unterschiedlich.
Oft sind es die erfolgreicheren Schüler*innen, meist aus gebildeteren, engagierteren Elternhäusern. Für sie ist Schule oft eher Erfolgserlebnis als Frustrationslieferant. Lernen, zuhören, konzentrieren, argumentieren fällt ihnen leichter, ist oft positiver konnotiert. Ihr Aufwand in Beteiligungsprozessen ist subjektiv geringer.
Dazu kommt: Auf der anderen Seite der Gleichung stehen keine vagen, oft utopisch eingeschätzten Aussichten, sondern konkrete Angebote.
Denn sie haben bereits mehrfach Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht. Ob als Klassensprecher*in, in Jugendgruppen, im Sport – sie wissen, dass Investitionen sich auszahlen, dass Wirkung und Anerkennung winken.
Für sie sind Teilhabeangebote tatsächlich eine Investition mit Gewinnerwartung, für viele andere eher eine Mehrbelastung mit vagem Versprechen.
Das ist der Grund, warum auch die hippsten Formate der Jugendbeteiligung meist nur einen kleinen, und oft ähnlichen Teil „der Jugendlichen“ erreichen.
Keine Frage: Auch diese können sich noch einmal deutlich unterscheiden. Die Motive zur Mitwirkung können Vertrauen auf Wirksamkeit und Demokratiegestaltung sein, aber auch eine grundsätzlich kritische Einstellung und Veränderungswille sind möglich – und bei manchen sogar ganz berechnende Aufwertung des eigenen Lebenslaufes.
Das ist der Grund, warum die aktuelle Studie für das Umweltbundesamt, über die wir kürzlich sprachen, zwei Zielgruppen lokalisierte: die „Kritischen“ und die „Kooperativen“.
Für beide werden unterschiedliche Angebote vorgeschlagen. Verkürzt gesagt: Die einen bekommen Selbstorganisation angeboten, die anderen Zertifikate.
Tatsächlich kann das funktionieren. Es berücksichtigt nur eines nicht: die übergroße Mehrheit der jungen Menschen, für die Beteiligung unattraktiv ist.
Weil sie keine Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht und von den dafür nötigen Anstrengungen schon durch die Schule die Nase voll haben.
Deshalb sind Beteiligungsangebote für sie unattraktiv: Weil es eben keine Angebote sind, sondern Aussichten. Und für Aussichten ist die Investition zu groß, zu bedrohlich, zu unangenehm.
Es ist das Grunddilemma der Beteiligung: Dass sie leicht immer nur jene erreicht, die Beteiligungserfahrung haben. Das ist messbar, sogar sehr klar: Ein einziges positives Selbstwirksamkeitserlebnis in der Biographie verändert die grundsätzliche Beteiligungsbereitschaft erheblich.
Diese Wirkung ist sogar „sozial vererbbar“. Positive Selbstwirksamkeitserfahrungen der Eltern können die Bereitschaft der Kinder, sich in solchen Prozessen einzubringen, deutlich erhöhen.
Die aktuellen Studien zur Sozialstruktur der „Fridays“ sind in dieser Hinsicht signifikant.
Junge Menschen für Beteiligung zu gewinnen, ist also gar nicht so schwer. Nur sind es eben auch hier in der Regel wieder die ähnlichen Milieus, wie wir sie auch bei den Erwachsenen beobachten.
Wollen wir auch die anderen begeistern, müssen wir das Köpenick-Syndrom überwinden. Es reicht nicht aus, Selbstwirksamkeit in einem Beteiligungsprozess in Aussicht zu stellen.
Tatsächlich tun viele Prozesse nicht einmal das.
Die regelmäßig abgehaltenen „Jugendwahlen“, bei denen im Umfeld der Bundestagswahlen eigene Wahlen simuliert werden – ohne dass die Ergebnisse irgendwelche Wirkung hätten, sind so ein Beispiel.
Ebenso wie andere Projekte. „Schule als Staat“ ist häufig so ein gut gemeintes, aber völlig absurdes Format. Es produziert Selbstwirksamkeitserfahrungen auf Zeit, erkennbar ohne Relevanz für den realen Schulalltag nach Projektende und dann auch häufig nur für die wenigen „Regierenden“, in der Praxis fast immer auch noch genau jene Schülervertreter*innen aus besagten wirksamen Milieus.
Am Ende sind solche und ähnliche Formate in der Praxis kaum mehr als Nachwuchstraining für künftige politische Eliten.
Was bleibt, sind zwei Erkenntnisse:
- Beteiligung muss für junge Menschen immer (auch) konkrete Wirkung ermöglichen und sich an den eigenen konkreten Lebensumständen orientieren.
- Das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung.
Denn: Selbst eine so angemessene, wirksame, gut moderierte Beteiligung entfaltet für viele junge Menschen keine Attraktivität, solange die Selbstwirksamkeit nur eine Aussicht ist und kein Angebot.
Wer dieses Angebot aber als solches erkennen soll, muss es kennen.
Der Dealer auf dem Schulhof befolgt das Prinzip schon lange: Der erste Schuss ist gratis.
Nun ist Selbstwirksamkeit keine Droge. Und Demokrat*innen sind keine Dealer.
Aber die Idee, Selbstwirksamkeit nicht nur als vage Aussicht am Ende eines langen Weges anzubieten, sondern niederschwellig zu organisieren, ist tatsächlich genau der Schlüssel, den wir brauchen.
Wie dieser Schlüssel aussieht, wie wir ihn einsetzen und warum es manchmal auch ein Dietrich tut – das schauen wir uns in der kommenden Woche gemeinsam an.




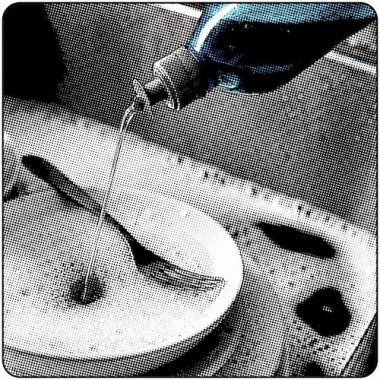
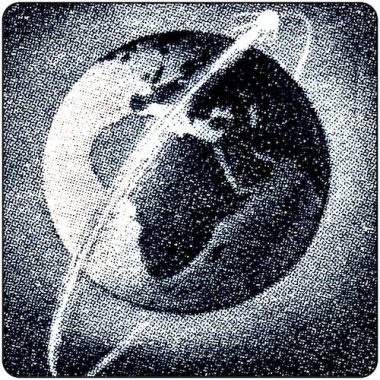


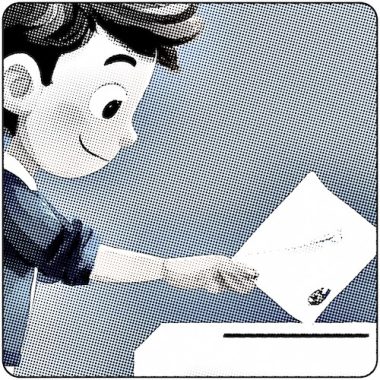
Als Praktiker der Jugendbeteiligung kann ich nur immer wieder betonen wie einschneidend für junge (allerdings auch für ältere) Menschen auch nur ein einziges positives Erlebnis ist. Aus meiner Sicht sind zwei Dinge am erfolgsversprechendsten: 1. Alle jungen Menschen an einer konkreten Entscheidung beteiligen, in dem Sinne dass sie tatsächlich entscheiden. Das tun sie zum Beispiel beim Zukunftshaushalt in Werder (Havel) (zukunftshaushalt.de), nun schon zum zweiten Mal. 200.000€ werden zweijährig zur Verfügung gestellt. Alle können Ideen einreichen, die Stadtverordneten können Vorschläge durch einen aktiven Beschluss ausschließen, wenn aber gewählt wird ist die Wahl bindend. Das, was die Schüler und Schülerinnen (und zwar alle ab der 4. Klasse) auswählen wird umgesetzt. Nicht nur erleben die Kinder tatsächliche Wirksamkeit (wenn sie z.B. ein Jahr später die Seniorenbänke sehen, für die sie nämlich auch abgestimmt haben). Sondern zusätzlich diskutiert die gesamte Jugend der Stadt plötzlich darüber, was ihnen wichtig ist. Ich würde mir wünschen dass es solche Zukunftshaushalte auf allen politischen Ebenen ( Kommunen, Länder, Bund, EU) gibt. Wenn Kinder und Jugendliche schon nicht wählen dürfen, dann sollten wir ihnen wenigstens einen Teil unserer Ressourcen zur Verfügung stellen. Die zweite erfolgsversprechende Option ist tatsächlich die Zufallsauswahl. Allerdings so, dass die Selbstselektion minimiert wird. Dies kann einerseits dadurch erreicht werden, dass Angebote während der Schulzeit stattfinden (Rückmeldeqouten von über 20%), oder aber z.B. so wie beim Jugendrat in Brandis im letzen Jahr, wo in jeder Klasse gelost wurde, oder aber durch das Aufsuchende Losverfahren. In Brandis wurde so auch sichergestellt, dass es eine Rückkopplung an alle Jugendlichen der Stadt gab. Hier nahmen Jugendliche teil, die von sich aus nie an irgendwelchen bisherigen Angeboten teilgenommen hatten, nach zwei Terminen aber sich sogar trauten mit einer Ministerin auf dem Podium zu diskutieren. Sie werden sich ihr Leben lang daran erinnern. Und es hoffentlich vererben…
Sehr interessant! Wie kann politische Teilhabe von Jugendlichen erfolgen? Da bin ich aber jetzt auf den nächsten Artikel sehr gespannt.