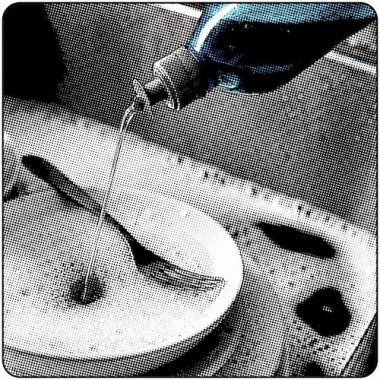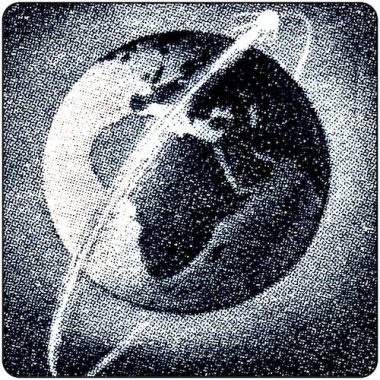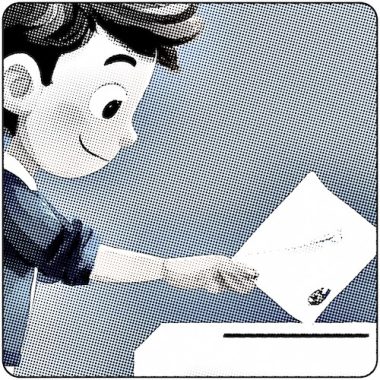Ausgabe #145 | 13. Oktober 2022
Alles wird anders
„Don’t be a Karen“ ist in den USA seit einigen Jahren fester Bestandteil des dortigen Sprachschatzes.
„Sei keine Karen“ gilt dort als Ermahnung, sich nicht zickig zu verhalten. Warum ausgerechnet der Vorname Karen als mahnendes Beispiel herhalten muss, hat auch auf dieser Seite des Atlantik manch eine Redaktion beschäftigt.
So fragte die Berliner Zeitung in einem Beitrag „Wer ist Karen?“, der Schweizer Rundfunk titelte „Wir müssen über Karen reden“ und der britische Guardian untersuchte die Frage „What exactly is a ‚Karen‘?“.
Tatsächlich kann heute niemand mit Sicherheit sagen, wer jene ominöse, erste Karen war. Es ist ein Platzhaltername für einen bestimmten Stereotypen.
Seit das Internet immer nur einen Klick weit entfernt ist, werden täglich tausende absurde Alltagssituation in die große Blase gepumpt. Dazu gehören auch, gerade in den USA, Fälle von alltäglichem Rassismus.
Und viele davon folgen einem ähnlichen Muster. Typische Merkmale für Karens sind weiße Hautfarbe, offensichtliche soziale Privilegierung und arrogantes, oft auch rassistisches Auftreten. Karens sehen sich stets im Recht, auch wenn das Gegenteil für alle anderen offensichtlich ist. Sie nehmen keine Rücksicht auf andere. Besonders gern drangsalieren sie Kinder nichtweißer Hautfarbe. In Geschäften wird von Karen gerne der „Geschäftsführer“ verlangt, bei anderen Situationen wird die Polizei gerufen, auch wenn es sich nur um Lappalien handelt.
Tatsächlich wurden die „Karens“ zunächst im Umfeld des Rassismus thematisiert. Heute ist die Symbolik etwas weiter gefasst.
Im Grunde sind diese „Karens“ Menschen, die aufgrund ihrer privilegierten sozialen Stellung ein relativ gutes, sicheres Leben führen – aber dennoch unglaublich schnell in die Luft gehen, wenn sie etwas irritiert, verunsichert oder auch nur minimal in ihren Privilegien einschränkt.
Karens sind oft rassistisch, meist ungeduldig, immer arrogant, aber eines sind sie nicht: resilient.
Wenn es nicht nach Plan läuft, nach ihrem Plan, dann ist das für sie unerträglich. Sie können es nicht ertragen – und das macht sie so schwer erträglich für andere.
In der vergangenen Woche haben wir uns mit Resilienz beschäftigt. Wir haben gesehen, dass Resilienz nicht nur Menschen stabiler macht, sondern auch Demokratien.
Das ist gut. Und wichtig. Allerdings stehen wir vor einer Herausforderung: Wir wollen, dass unsere Demokratie stabil bleibt. Wir wissen aber auch, dass sich unsere Gesellschaft in naher Zukunft ziemlich grundlegend verändern wird.
Der schöne Begriff der „Transformation“ ist gerade deshalb aktuell so beliebt, weil er nahezu beliebig mit Inhalt gefüllt werden kann.
Für viele Manager*innen ist „Transformation“ vor allem digitale Transformation: mehr Technik, weniger Beschäftigte, neue Geschäftsmodelle im virtuellen Raum mit nahezu unendlichen Gewinnphantasien.
Gleichzeitig sprechen andere von „sozialökologischer Transformation“. Also der Herausforderung, eine zukunftsfähige Art des Lebens und Wirtschaftens zu gestalten, die den Klimaschutz ebenso berücksichtigt wie die soziale Gerechtigkeit.
Nun könnte man die ersten Phantasien rücksichtslos und profitorientiert nennen. Und die zweiten hoffnungslos naiv.
Das ändert aber nichts daran, dass beide Transformationen stattfinden. Neben-, mit- und gegeneinander zugleich. Zusammen mit noch ein paar mehr Transformationen in der Geopolitik und anderen Bereichen.
Aus der Geschichte wissen wir aber, dass oft schon eine einzige Transformationsherausforderung (bspw. die Industrialisierung) ganze Gesellschaften zerlegte und globale Neusortierungen brachte.
Völlig unabhängig davon, wie sich die multiplen Transformationen gestalten, die uns bevorstehen – naiv wäre nur eines: zu glauben, dass sich das schon irgendwie von alleine und ohne große Verwerfungen regelt.
Die Karens dieser Welt werden sich warm anziehen müssen. Für sie wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich viel ändern. Und da wird es auch der „Geschäftsführer“ nicht richten können.
Es ist völlig offen, ob Demokratien in der Lage sind, diese Veränderungen zu bewältigen. Im Klimaschutz zum Beispiel haben wir den Beweis bislang nicht erbringen können. Dass es Diktaturen bislang auch nicht besser machen, ist genauso wahr, aber löst das Problem nicht.
Sicher ist nur eines: Wenn die Demokratien diese umfangreichen und unkalkulierbaren Transformationsprozesse nicht nur überleben, sondern gestalten wollen, dann müssen sie ihre Stärke ausspielen.
Und das ist: breite gesellschaftliche Aushandlungsprozesse immer wieder neu zu organisieren. Diese Art der Teilhabe möglichst großer Teile der Gesellschaft lernen wir gerade erst. Wir sind zu oft noch zögerlich, halten sie zu oft noch für überflüssig, setzen zu oft noch auf vermeintliche Effizienz.
Aber wir lernen.
Die Beteiligung wird auch in Deutschland immer besser.
Und das muss sie auch. Denn nur Menschen, die den Wandel tatsächlich aktiv mitgestalten, entwickeln die Stärke, den Wandel auch zu bewältigen – also individuelle Resilienz aufzubauen und so gesellschaftliche Resilienz zu stärken.
Eben weil diese Resilienz demokratische Strukturen, Prozesse und Institutionen stabilisiert, schafft sie auch die Voraussetzungen, den Wandel auf demokratische Weise zu gestalten. Weil resistente Gesellschaften stabiler sind, können sie Veränderung besser organisieren.
Das (fast) alles anders werden wird, ist klar. Ob es uns gelingt, diesen Wandel so zu gestalten, dass er mehr Gutes als Schlechtes produziert, hängt davon ab, wie demokratisch wir ihn organisieren können.
Dazu brauchen wir aber mehr Teilhabe von mehr Menschen zu mehr Themen.
Viel mehr.