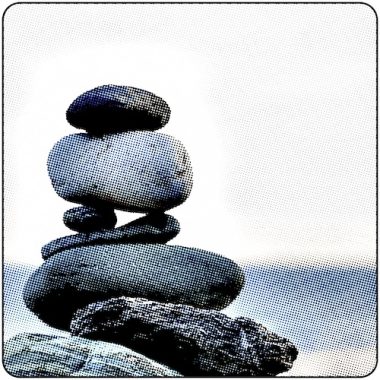Ausgabe #200 | 2. November 2023
Die glorreichen Sieben
Der Film gilt als einer der großen Klassiker des Kinos. Er hat Generationen von Regisseur*innen beeinflusst.
Dabei ist die Story des 1960 gedrehten Westerns „Die glorreichen Sieben“ relativ banal.
Ein bettelarmes mexikanisches Dorf wird regelmäßig von Banditen bedroht und ausgeraubt. Einige der Dorfbewohner suchen eine Grenzstadt zu den USA auf, um Gewehre für die Verteidigung zu kaufen. Sie erfahren dort von Chris, einem Revolvermann, dass ihnen ohne Kampferfahrung Gewehre nichts nutzen. Er rät ihnen, sich Männer mit Gewehren für eine bestimmte Zeit zu mieten.
Das Geld reicht gerade mal für sechs Söldner – und einen jugendlichen Heißsporn, den keiner will, der sich aber nicht abwimmeln lässt.
Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: Ein rasant inszeniertes Gemetzel folgt dem anderen. Am Ende sind die meisten Banditen tot – und die meisten Revolvermänner auch.
Schließlich bleibt den überlebenden Söldner nur die bittere Erkenntnis: „Nur die Bauern konnten gewinnen. Wir haben verloren! – Wir verlieren immer!“
Viele Geschichten ließen sich zu diesem Klassiker erzählen.
Zum Beispiel, wie der damals noch relativ unbekannte Steve McQueen den bereits als Superstar bekannten Yul Brynner permanent mit Einlagen nervte, die so nicht im Drehbuch standen.
Oder dass die Story in weiten Teilen von dem älteren japanischen Film „Die sieben Samurai“ geklaut wurde. Die Handlung wurde lediglich in den Wilden Westen verlegt, nicht einmal die Zahl der überlebenden Protagonisten wurde verändert.
Am Ende spielte viel hinein in die Entstehung eines Mythos. Wer und was welchen Anteil hatte, ist kaum zu bestimmen.
Das gilt auch für die Frage, welcher der sieben Revolvermänner (oder Samurai) letztlich am meisten zum Erfolg beitrug.
Ichs selbst habe den Film sicher mehr als siebenmal gesehen. Und könnte die Frage doch nicht beantworten.
Irgendwie brauchte es alle.
Und genau deshalb nutze ich die glorreichen Sieben auch gerne in Workshops zum Design demokratischer Prozesse.
Das ist gut zu merken – und es macht Sinn. Denn es sind genau sieben klassische Herausforderungen, die dialogische Prozesse bewältigen müssen.
Sieben Herausforderungen, die solche Prozesse ins Trudeln bringen können.
Siebe Herausforderungen, die immer wieder unterschiedlich relevant sind, aber immer da.
Sieben Herausforderungen, die tatsächlich immer mit demselben Prinzip angegangen werden können – und sollten. Es sind:
1. Die Bestimmung des Themas
2. Die Auswahl und Gewinnung der Beteiligten
3. Die Planung des Prozesses
4. Der Umgang mit Konflikten
5. Die Fixierung von Ergebnissen
6. Die Organisation der Wirkung
7. Die Reflektion von Lernprozessen
Wenn wir dialogische Prozesse planen, kann es sehr hilfreich sein, sich genau diese sieben Punkte einmal bewusst anzuschauen.
Und wenn wir im Nachhinein wissen wollen, warum ein Prozess besonders erfolgreich, eher so lala oder völlig unzufriedenstellend war?
Auch dann lohnt es sich, alle sieben Punkte zu checken.
Warum?
Weil die Frage, wie wir die Antworten auf die Herausforderungen finden, ganz entscheidend für die Chancen und Risiken des Gesamtprozesses sind.
Wenn wir ein Thema haben, dass kaum Betroffenheit auslöst, kann der beste Prozess nichts retten. Wenn es zu komplex ist, werden Diskurse kaum funktionieren. Ist es emotional zu sehr aufgeladen, braucht es ein wirklich cleveres Dialog-Design. Kann zu dem Thema gar kein Wirkungsspielraum angeboten werden, taugt es nix. Die Themenfindung ist definitiv die erste und prägendste Herausforderung für jeden Prozess.
Was tun, wenn man sich nicht sicher ist? Fragen Sie die Menschen. Ob aktivierende Umfrage, Fokusgruppen oder Runde Tische mit gesellschaftlichen Gruppen, wenn die Frage lautet „Wie wissen wir, welches Thema dialogreif ist?“, dann ist Partizipation die Antwort.
Wen sollen wir zu diesem Thema beteiligen? Wir können eine Stakeholder-Analyse machen. Das ist gut. Noch besser: Wir fragen die Menschen. Wer sich für ein Thema interessiert, weiß meist auch, wen es sonst noch betrifft, wer dabei sein sollte. Gerade, wenn Beteiligung breit werden soll, ist die Antwort auf diese Herausforderung: Partizipation.
Und wie soll der Prozess letztlich aussehen? Welche Zwischenstufen braucht es? Welchen Input? Welche Formate? Man kann Expert*innen fragen. Oder die Beteiligten. Oder am besten: Beide. Ja, auch hier ist Partizipation der Schlüssel zu guten und vor allem akzeptieren Prozessen.
Je besser ein Prozess Menschen in den Dialog bringt, desto klarer treten Konflikte auf. Das ist gut. Darum geht es. Konflikte sind kein Problem, sondern Treibstoff von Beteiligung. Deshalb ist der Umgang damit auch keine „Problembeseitigung“ durch die Moderation, sondern etwas, was die Beteiligten gemeinsam leisten. Und erneut gilt: Konflikte in der Partizipation werden partizipativ bearbeitet.
Gute Beteiligung produziert Ergebnisse. Doch wer fixiert diese? Bleibt es am Ende beim freundlichen „Danke für Ihren Input?“ oder endet der Prozess mit einem partizipativ formulierten Ergebnis? Entscheidend für die langfristige Akzeptanz von dialogischen Angeboten ist: Die Ergebnisse von Partizipation werden partizipativ fixiert.
Doch in der Partizipation geht es nicht nur um Ergebnisse, es geht auch um deren Wirkung.
Wen erreichen die Ergebnisse? Wie werden sie aufgenommen? Wie verarbeitet? Es ist das Recht all jener, die daran beteiligt waren, sich auch hier zu engagieren. Deshalb ist die Frage „Was passiert danach?“ legitimer Bestandteil Guter Beteiligung. Ob öffentliche Präsentation, Gespräche mit Entscheider*innen, Anhörung in Gremien: auch hier lautet das Prinzip, jetzt nicht mehr überraschend: Partizipation.
Der abschließende Blick zurück ist wichtig. Um zu lernen, was wir beim nächsten Mal anders, besser, wirksamer umsetzen wollen. Das können die Beteiligenden intern machen. Oder sich extern evaluieren lassen. Oder dies gemeinsam mit den Beteiligten tun.
Oder alle drei Varianten wählen.
Die Evaluation partizipativ zu denken, macht sie stark und aussagefähig – und ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung gegenüber den Mitwirkenden. Und davon gibt es nie zu viel.
Dialogische Prozesse zu planen und zu organisieren ist anspruchsvoll.
Man muss auf Vieles achten. Es lohnt sich immer, dabei noch einmal eine Extrarunde und den glorreichen Sieben zu drehen.
Und im Zweifel jede Herausforderung noch einmal darauf zu prüfen, ob wir nicht eine noch bessere Antwort darauf finden können.
Und das heißt meist: eine noch partizipativere.