Ausgabe #261 | 2. Januar 2025
Wie retten wir die Demokratie?
Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns. Und das neue Jahr wird wohl nicht einfacher werden. Das gilt auch für die Demokratie. Sie ist in vielen Ländern unter Druck. Erosionserscheinungen sind unübersehbar. Auch in unserem Land.
Zahlreiche Studien sind in den vergangenen Monaten erschienen, weitere in Vorbereitung. Sie beschreiben die Symptome. Sie dokumentieren soziale und politische Spaltungsprozesse.
Selten geben sie Antworten auf die Frage, wie die Erosion der Demokratie gestoppt werden kann. Das hat viele Gründe.
Der Hauptgrund hat eine unangenehme Komponente: Die Erosion der Demokratie ist ein komplexer, lange andauernder Prozess mit unterschiedlichen Pfaden aber ähnlichem Trend in vielen Ländern.
Daraus folgt, dass es keine schnelle „Lösung“ geben kann.
Demokratie hat viel mit Vertrauen zu tun. Und von Vertrauen wissen wir: Es aufzubauen, dauert lange. Es zu zerstören dagegen nicht.
Es gibt keinen vernünftigen Grund, anzunehmen, dass die Stärkung der Demokratie im Schnellverfahren gelingen könnte.
Entsprechend mühsam arbeiten sich einschlägige Akteure an Therapievorschlägen ab. Insbesondere die beeindruckend hohe Zahl an populärwissenschaftlichen Sachbüchern mit knackigen Titeln liefert hier wenig.
Sie heißen „Retten wir unsere Demokratie!“, „Erste Hilfe für Demokratie-Retter“ oder „Demokratie neu denken“. Und sie enthalten viele wahre Sätze. Ihre „Rettungsstrategien“ sind dagegen erstaunlich dünn.
Das Problem setzt sich fort. Auch in Werken hoch seriöser Autorinnen und Autoren. Der Soziologe Steffen Mau bietet zum Beispiel in seinem lesenswerten Besteller „Ungleich vereint“ eine präzise Analyse der Disparitäten in der ost- und westdeutschen Gesellschaft. Am Ende aber bleibt er erstaunlich naiv in der monotherapeutischen Handlungsempfehlung: „Mehr Bürgerräte“.
Manche immer wieder zitierten Studien schaffen es nicht einmal unfallfrei bis zum Ratgeberteil. Weil sie schon in der Methodik erratische Volten schlagen.
So kommt die von der Friedrich-Ebert-Stiftung beauftragte Studie „Vertrauen in die Demokratie in Krisenzeiten“ zu dem Schluss: „Die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie ist trotz vielfältiger Krisen stabil“.
Die Autor*innen weisen immerhin selbst darauf hin, dass diese Stabilität die Stabilität einer Minderheit sei.
Das wirkliche Problem der Studie liegt aber in einem anderen Bereich. Sie diskutiert ausgiebig „Vertrauen in die Demokratie“, fragte aber in den über 2.500 Interviews gar nicht danach. Ermittelt wurden Vertrauen in andere Menschen, in Institutionen und in Akteursgruppen. In Bezug auf die Demokratie bezogen wurde nicht das Vertrauen sondern die Zufriedenheit ermittelt.
Das ist keine soziologische Haarspalterei. Denn Zufriedenheit und Vertrauen sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ganz besonders im Bezug auf die Demokratie.
Da gibt es eine Reihe von potentiellen Missverständnissen, welche die Qualität von Diagnosen ebenso ruinieren können, wie die Qualität von Therapien.
Weder Qualität noch Stabilität von Demokratie können durch den Grad der Zufriedenheit gemessen werden. Oft ist es genau die Unzufriedenheit mit Prozessen, Institutionen oder Ergebnissen, die zu demokratischem Engagement führen.
Ähnlich missverstanden wird häufig die Rolle von Vertrauen.
Vertrauen ist keine Voraussetzung für Demokratie. Tatsächlich dienen demokratische Prozesse vor allem der gesellschaftsstabilisierenden Organisation von Misstrauen. Die meisten Regeln, Gesetze und Paragraphen sind von Misstrauen geprägt. Selbst Wahlen sind vor allem ein Format des Misstrauensmanagements.
Das Konzept von Vertrauen als Basis stabiler Gesellschaften war nie „Demokratie“, sondern „Guter König“. Auch aristokratische Herrschaftsformen oder die immer mal wieder diskutierte „Expertokratie“ brauchen Vertrauen als Grundlage.
Die Rolle von Vertrauen in der Demokratie ist eine andere. Misstrauen in Regierende, in Parteien, in Institutionen, in Lobbyverbände ist in einer Demokratie elementar und ein Zeichen von Stärke.
Es geht um ein anderes Vertrauen, dass Demokratie benötigt: Um das Grundvertrauen in das Design der Demokratie an sich, um die Zuversicht, dass widerstreitende Interessen langfristig ausbalanciert werden können.
Um das Vertrauen an sich geht es. Aber eben auch um das Vertrauen in sich. Um das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit als relevanter Teil der demokratischen Gesellschaft. Dieses Vertrauen ist es letztlich, welches das Funktionieren von Demokratie überhaupt ermöglicht.
Und dieses Vertrauen wird nicht oder kaum durch seltene Wahlteilnahmen, durch Parteiprogramme oder -plakate, durch seriöse oder populistische Medienberichterstattung, durch asoziale Medien oder Meinungsumfragen aufgebaut.
Der einzige Weg dazu: Die regelmäßige Erfahrung politischer Wirksamkeit. In der Kommune, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Verein.
Genau darum ist echte, wirksame Teilhabe, im Idealfall dialogische organisiert, das zentrale Element zur Stärkung der Demokratie.
Die gute Nachricht lautet also: Es gibt das universelle Allheilmittel.
Die herausfordernde Nachricht lautet: Wir brauchen davon eine gegenüber heute vieltausendfach erhöhte Dosis. Und das über einen langen Zeitraum. Mit einem Bürgerrat des Bundestags pro Wahlperiode kommen wir da nicht ganz hin. Auch nicht mit 20. Oder 200.
Am Ende sind es die konkreten Demokratieerfahrungen der Vielen vor Ort, die zählen. Genau jene Demokratieerfahrungen, dies es aktuell noch viel zu selten gibt. Die Antwort auf unsere heutige Frage ist also weder einfach, noch schnell, aber dafür klar:
Demokratie muss erlebt werden. Sonst stirbt sie.
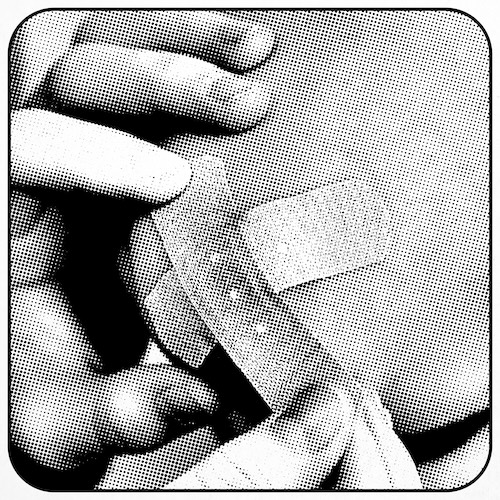
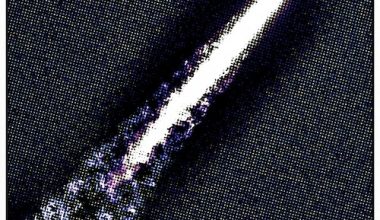







Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube nicht einmal, dass diese Demokratieerfahrungen der entscheidende Punkt sind. Vielleicht findet der Autor ja diese Demokratieerfahrungen für sich unglaublich wichtig und toll. Aber viele Menschen wollen einfach ein Leben, bei dem sie sich nicht dauernd Sorgen darüber machen müssen, ob sie demnächst noch Miete und Lebensmittel bezahlen können, ob die Rente im Alter reicht, wie es ihren Kindern in der Zukunft geht etc.
Darauf nimmt die Politik einfach viel zu wenig Rücksicht. Im Gegenteil. Die Politik versucht vor allem, Wachstum zu erreichen und gibt dazu den Reichsten immer mehr – in der Hoffnung, dass dadurch dann Wachstum kommt. Aber selbst wenn es mal Wachstum von 1-2 % gibt, kommt das bei den meisten nicht an.
Und als Alibipolitik werden dann die ärmsten drangsaliert bis zum geht nicht mehr.
Stattdessen müsste eine gerechtere Politik gemacht werden, bei dem gewaltigen Gewinne in unserer Wirtschaft gerechter verteilt werden.