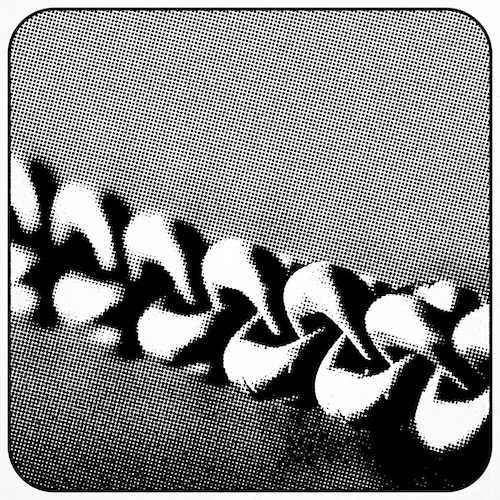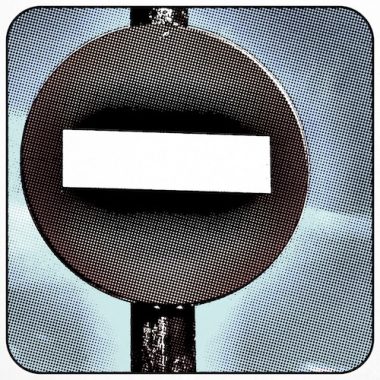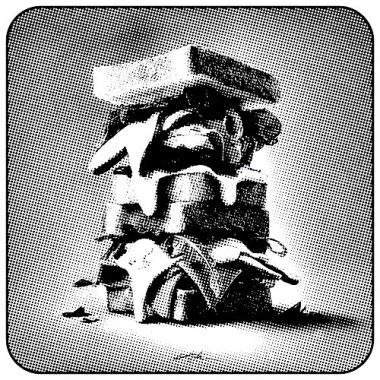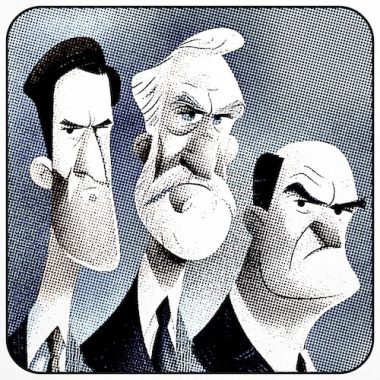Ausgabe #268 | 20. Februar 2025
Wissen und Werte
Die Zuverlässigkeit von Wahlprognosen ist in den vergangenen Jahren ziemlich unter die Räder gekommen.
Bei den beiden vergangenen Präsidentschaftswahlen in den USA lagen die meisten Umfragen ziemlich daneben. Auch in Deutschland erleben wir an Wahltagen immer wieder Überraschungen.
Die Prognose, ob am kommenden Sonntag FDP, BSW und/oder Linke die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, sieht je nach Institut unterschiedlich aus.
In der öffentlichen Wahrnehmung sind diese Umfragen zunehmend weniger präzise.
War das früher nicht mal besser?
Ja.
Und Nein.
Zum einen waren Prognosen in einem Land mit mehr als 80 Prozent Stammwähler*innen und gerade mal drei Parteien im Parlament natürlich weniger risikobehaftet.
Zum anderen liegt es nicht an den Umfragen, sondern am Umgang damit.
Für die meisten Umfragen werden nur 1.000 bis 2.000 Personen befragt, das Ergebnis dann hochgerechnet.
In der Forschung gehört deshalb zu jeder Untersuchung eine Art Streubereich, der statistische Fehler einbezieht. Konfidenzintervall nennt sich das.
bei den meisten Wahlumfragen liegt das bei ungefähr 2,5 Prozentpunkten. Sind also für die FDP 4 Prozent prognostiziert, können es am Ende eben auch nur 1,5 Prozent werden – oder 6,5 Prozent. Ohne dass die Umfrage „fehlerhaft“ wäre – was ja noch dazu kommen kann.
Das gilt im Grunde für viele Informationen, die als „Fakten“ wahrgenommen werden: Fehler entstehen nicht nur bei deren Erhebung, sondern eben auch bei der Verarbeitung, also der Interpretation.
So könnte man aufgrund einer aktuellen Umfrage zum Beispiel behaupten:
US-Bürger*innen wollen, dass die Entwicklungshilfegelder verfünfzigfacht werden!
Das ist kein Tippfehler. Aber auch nicht die ganze Wahrheit.
Kürzlich wurde eine Umfrage veröffentlicht, nach der die US-Bürger*innen durchschnittlich glauben, dass die USA rund 25 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben.
Das war den meisten Menschen zu viel. Befragt nach einer Größenordnung, die ihnen fair und gerecht erscheine, gaben sie im Schnitt 10 Prozent an.
Tatsächlich liegt die reale Quote in Deutschland bei 0,83 Prozent, in den USA sogar nur bei 0,22 Prozent.
Fakten und Wahrnehmung gehen hier so weit auseinander, dass darauf basierende Schlüsse und Ziele für Chaos sorgen. Würde man die US-Bürger*innen nämlich fragen, ob man die Ausgaben um den Faktor 50 erhöhen sollte, käme eine ganz andere Antwort heraus.
In der Praxis sind Fakten ebenso wenig absolut wie Werte. Beide stehen in Wechselwirkung.
Allerdings eben nicht so einfach, wie wir das gerne glauben würden: Stimmen die Fakten, wird es leichter, ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen.
Leider nicht. Das erfahren wir auch in Prozessen der demokratischen Teilhabe immer wieder.
Dort wird in schöner Regelmäßigkeit immer wieder die Faktenvermittlung an den Anfang gestellt – in der Erwartung, dass sich die Diskurse davon leiten lassen.
Das tun sie, aber eben nur bedingt berechenbar.
Weil die Verarbeitung von Fakten bereits von den Werten der Beteiligten beeinflusst wird.
Davon hängt ab, wie wir Fakten interpretieren, wie sehr wir sie akzeptieren, wie wir sie mit anderen Fakten ins Verhältnis setzen.
Schon mancher Beteiligungsprozess hat sich bereits ganz am Anfang zerlegt, weil der Kampf verbissen um die Fakten – und ihre Relevanz – geführt wurde. Und das als „Stellvertreterkrieg“, weil letztlich unterschiedliche Werte dahinterstanden. Über die zu sprechen, gelang aber nicht, weil schon die Faktendebatte eskalierte.
Gerade in der Beteiligung geht es oft gar nicht um den Umgang mit Wissen. Sondern viel entscheidender ist der gemeinsame Umgang mit Nichtwissen.
Gerade in konfliktbelasteter Umgebung kann es deshalb sinnvoll sein, bewusst nicht die Fakten an den Anfang zu stellen, sondern die Werte.
Diese Strategie empfiehlt auch die Kommunikationsberaterin Marie-Theres Braun. Sie sagt: Wer zuerst über Werte spricht, entdeckt erstaunlich viel Gemeinsamkeiten.
Und da, wo es Unterschiede gibt, fällt es anschließend leichter, die anderen zu verstehen.
Vor allem Entscheidungen in der Verwaltung sind faktenbasiert. Da liegt es nahe, eventuell Beteiligte zuerst einmal mit dem „richtigen“ Wissen aufzuladen.
Doch so funktionieren Menschen nicht. Schon gar nicht jene, die sich aus einer wahrgenommenen Betroffenheit heraus beteiligen.
Und das ist die Regel.
Diese Betroffenheit hat immer etwas mit Wissen zu tun. Auch mit Nichtwissen. Mit Halbwissen. Mit Scheinwissen.
Doch das Wissen zu „reparieren“, ist keine Strategie, die im realen Leben funktioniert. Weil es eben noch andere Faktoren gibt. Emotionen, Vertrauen, Misstrauen, Werte.
Der ganze Mix ist immer dabei. Und bei jedem Menschen anders. Aber immer bestimmend für dessen Umgang mit Fakten.
Deshalb ist es eine gute Idee, sich in besonders konfliktträchtigen Prozessen zunächst einmal darum zu kümmern.
Es geht dabei nicht darum, Vertrauen zu schaffen, Emotionen abzubauen oder Werte zu ändern.
Sondern: darüber zu sprechen. Gemeinsamkeiten zu ermitteln, Unterschiede zu erkennen und zu respektieren.
Erst wenn wir das geleistet haben, sind wir in der Lage, gemeinsam Wissen zu verarbeiten.
Und mit Nichtwissen umzugehen.
Und genau das ist ein zentraler Erfolgsfaktor von Guter Beteiligung.