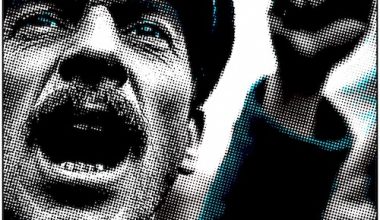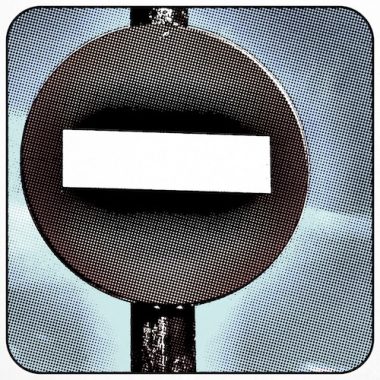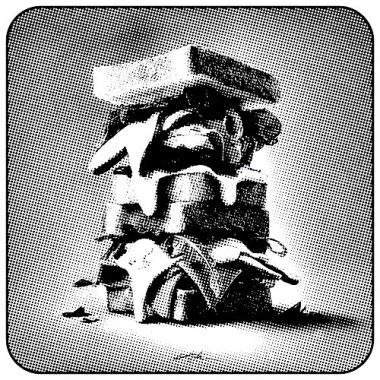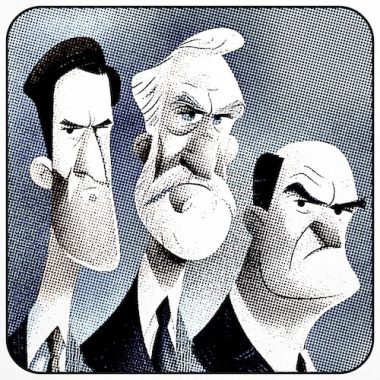Ausgabe #277 | 24. April 2025
Hilflose Hunde
Der amerikanische Psychologe Martin Seligman ist eine Autorität. Und das seit vielen Jahren.
Schon 1966 wurde er Präsident des weltgrößten Dachverbandes für Psychologie, der American Psychological Association.
Er war zugleich erfolgreich und umstritten.
Unter anderem weil er diverse populäre Ratgeber in sensationellen Auflagen verkaufte, mit so marktkompatiblen Titeln wie „Das optimistische Kind“ oder „Wahre Freude“.
Auch sein Hang zu außergewöhnlichen Experimenten – unter anderem mit Hunden – brachte ihm Kritik ein.
Sein berühmtestes Experiment hatte zwei Phasen. In Phase eins fügte Seligman einer Gruppe von Hunden in zufälligen Abständen mit Elektroschocks erhebliche Schmerzen zu.
Diese Hunde teilte er in zwei Gruppen. Einige Hunde konnten den Elektroschocks entkommen, indem sie lernten, einen Schalter bzw. Hebel zu drücken, wodurch die elektrischen Impulse gestoppt wurden.
Eine zweite Gruppe von Hunden bekam ebenfalls Elektroschläge, jedoch funktionierte bei diesen Hunden der Schalter zum Ausschalten der Schläge nicht. Ihr Verhalten hatte also keinerlei Auswirkungen. Egal was sie taten, sie wurden immer weiter gequält.
In Phase zwei des Experiments wurden die Hunde in einer sogenannten Shuttle-Box untergebracht.
Diese bestand aus zwei identischen Boxen, die über eine Öffnung miteinander verbunden waren, sodass die Hunde von der einen zur anderen Seite wechseln konnten.
Ein Ton meldete nun den Beginn der Elektroschocks.
Die Hunde der ersten Gruppe, die gelernt hatten, mit ihrem Verhalten dem elektrischen Reiz zu entkommen, lernten sehr schnell, beim Erklingen des Tones in die andere Box zu wechseln und so dem Schock zu entgehen.
Mit der Zeit lernten diese Hunde sogar, die Schocks durch einen vorzeitigen Wechsel der Boxen gänzlich zu vermeiden.
Die Hunde der Gruppe zwei hingegen blieben überwiegend lethargisch in einer Box liegen und ließen die Schocks passiv über sich ergehen. Und das, obwohl sie die Chance hatten, zu entkommen.
So brutal das Experiment war, Seligman konnte darstellen, dass es so etwas wie „erlernte Hilflosigkeit“ gibt.
Wir kennen diese Entwicklung auch bei Menschen, zum Beispiel bei
Jugendlichen, die aus marginalisierten Familien kommen. Sie können Hilfen nicht nutzen, weil sie Schulversagen und staatliche Sanktionierungen so sehr verinnerlicht haben, dass ihnen jeder Antrieb fehlt, ihre Situation proaktiv zu verbessern.
Der von Seligman geprägte Begriff der erlernten Hilflosigkeit ist heute Grundlagenwissen in der Psychologie.
Er beschreibt die Erwartung eines Menschen, bestimmte Situationen oder Sachverhalte nicht kontrollieren und beeinflussen zu können.
Diese Selbstbeschränkung bzw. Passivität ist auf frühere Erfahrungen der Hilf- und Machtlosigkeit zurückzuführen. Das beeinflusst das weitere Erleben und Verhalten. Und es kann zu dramatischen motivationalen, kognitiven und emotionalen Defiziten führen.
Insofern ist das Konzept der erlernten Hilflosigkeit die negative Spiegelung zur Selbstwirksamkeitserfahrung, die wir in diesem Newsletter schon mehrfach betrachtet haben.
Und es ist ein Konzept, das im Bereich der politischen Teilhabe viel erklärt.
Zum Beispiel beim Wahlverhalten.
Wer in demokratischen Kontexten gelernt hat, dass es für ihn oder sie keine wirkliche Option aktiver Mitgestaltung gibt, geht eventuell nicht wählen. Oder geht wählen – aber nicht um die eigene Situation zu verbessern, sondern „denen da oben“ eins auszuwischen.
Menschen mit erlernter demokratischer Hilflosigkeit sind so gut wie nicht dazu zu bewegen, an Beteiligungsprozessen mitzuwirken.
Da können die Angebote noch so verlockend, die Themen noch so nah an der Lebenswirklichkeit sein. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen:
Im Bereich Demokratie ist erlernte Hilflosigkeit ein Massenphänomen.
Die bekannte Beteiligungspädagogin und Diplompsychologin Marina Weisband gab der neuen Fachzeitschrift „Beteiligen!“ kürzlich ein Interview. Darin berichtet sie von ihren Erfahrungen an deutschen Schulen:
„Das beobachte ich bei ganz vielen Schüler*innen von mir, vor allem bei den Älteren. Sie haben diese Hilflosigkeit schon gelernt. Sie wachsen in einer Umgebung auf, wo sie ihr Lebensumfeld ehrlicherweise kaum beeinflussen können: Sie müssen um 8 Uhr morgens da sein. Sie müssen 45 Minuten lang Mathe lernen. Und dann müssen sie in dieser 20-Minuten-Pause Hunger haben. Das heißt, sie sind da, um Erwartungen zu erfüllen. Und sie kriegen gute Noten und Belohnungen, solange sie das tun. Es wird aber gar nicht von ihnen erwartet, dass sie ihre Lebensumwelt gestalten, mit offenen Augen durch die Welt gehen, ihre Bedürfnisse formulieren und sich für ihre Mitschüler verantwortlich fühlen. Diese Form der Sozialisation, mit der wir schon das Leben in dieser demokratischen Gesellschaft anfangen, ist einem demokratischen Rollenbild gar nicht zuträglich.“
Marina Weisband und ihr Team versuchen deshalb intensiv, für diese Schülerinnen und Schüler kleinste, konkrete Selbstwirksamkeitserfahrungen möglich zu machen – und das mit erstaunlichem Erfolg.
Warum?
Weil sie mit extrem niedrigen Einstiegsschwellen arbeiten und dann immer ein wenig mehr anbieten.
Sie versucht gar nicht erst, die jungen Menschen für anstrengende, komplexe Prozesse zu gewinnen, sondern agiert als eine Art „Demokratie-Dealer“.
Sie gestaltet ihre Angebote so, dass die niedrigschwelligste mögliche Beteiligung gerade mal ein Klick ist: Die Schüler*innen stimmen für oder gegen eine Idee. Und dann kommt direkt eine weitere Option, dann ein Austausch von Meinungen, dann mehr.
Ihr Ziel: „Selbst wenn Schüler*innen völlig desinteressiert sind, bekommen sie es im Unterricht mit. Das ist wichtig! Man muss Beteiligung sogar passiv mitbekommen, wenn man nicht daran teilnimmt.“
Wenn wir also in der Beteiligung – völlig zurecht – beklagen, dass bestimmte Gruppen nicht oder kaum für klassische Beteiligungsverfahren zu gewinnen sind, dann könnten wir mehr und öfter Beteiligung gezielt so designen, dass sie „Erlernt Hilflose“ triggert.
Das sind dann oft kleinere, kürzere, auch weniger wirksame Angebote.
Aber es sind Angebote.
Wichtige Angebote.
Gerade für Menschen, die „gelernt“ haben, dass sie in unserer Demokratie wenig Wirksamkeit haben.
Davon gibt es viele. Zu viele.
Wenn die Demokratie diese Menschen wieder gewinnen will, dann wird sie ihnen etwas anbieten müssen.
So wie Hilflosigkeit gelernt wird, kann auch das Gegenteil gelernt werden.
Und wir wissen: Wenn Selbstwirksamkeit gelernt werden soll, muss sie vor allem:
Erlebt werden.