Ausgabe #108 | 27. Januar 2022
Im Hier und Jetzt
Die Bürgerbeteiligung in Deutschland hat in den vergangenen Jahren erheblich an Umfang und Qualität gewonnen. Sie ist eine Erfolgsgeschichte. Doch das heißt nicht, dass alles immer wirklich erfolgreich war, dass alles immer funktioniert, dass alle immer zufrieden sind.
Im Gegenteil: Häufig ist Beteiligung von Frust geprägt oder von Wirkungslosigkeit entwertet. Manchmal findet sie auch gar nicht erst statt. Weil sich zu wenig Beteiligte finden.
Wenn wir also lernen wollen, wie wir noch besser beteiligen können, dann sind wir gut beraten, uns nicht nur die beliebten „best practices“ anzuschauen. Denn da geht es häufig zu, wie bei den Instagram Influencern: Alles ist perfekt, shiny – und so weit weg von der Realität wie die Models auf den Covern der Regenbogenpresse.
Bei den Konsument*innen solcher „Vorbilder“ entsteht da weitaus eher Frust als Motivation, ganz besonders dann, wenn man seine eigenen Erfahrungen an diese Maßstäbe anlegt.
Dabei entstehen die nachhaltigsten Lernimpulse schon immer eher aus Niederlagen und Konflikten. Ein großer politischer Stratege sagte einmal: „Jeder Sieg ist in erster Linie eine Summe aus Niederlagen.“
Also schauen wir uns heute mal einige Beispiele an, bei denen die schöne neue Beteiligungswelt so gar nicht funktionieren wollte. Drei unterschiedliche Fälle, immer dasselbe Problem:
Kein Bock bei den Beteiligten.
In einer niederrheinischen Stadt plante das örtliche Jugendzentrum eine „Zukunftskonferenz“, großzügig finanziert aus Bundesmitteln sollten 300 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren an zwei Wochenenden ihre „Kommune der Zukunft“ entwerfen. Wie wollen sie in 20 Jahren in ihrer Stadt leben, lernen, arbeiten, mobil sein, ihre Freizeit gestalten? Trotz einer hippen Social-Media-Kampagne und Flyern an jeder Schule kamen zum ersten Wochenende gerade einmal 3 Teilnehmer*innen.
In einer mittelgroßen Kommune nahe Wolfsburg sollte ein „Agenda 2050 Prozess“ starten – gemeinsam mit Bürger*innen sollten Anforderungen an die Entwicklung der Kommune erarbeitet werden. Der Prozess war auf eineinhalb Jahre angelegt. Im ersten Jahr geschah – nichts. Es dauerte 14 Monate, um eine 20-köpfige Gruppe zu rekrutieren – sie bestand in erster Linie aus Vereinsvorsitzenden und Angehörigen von Gemeinderät*innen, keiner unter 30, keiner über 60.
„Unsere Stadt im Klimawandel“ – mit diesem ansprechenden Titel plante eine schwäbische Kleinstadt eine Folge von Beteiligungsformaten. Es ging um die Anpassung an Hitzewellen und Starkwetterereignisse. Zum ersten Informationsabend kamen immerhin noch 18 Personen, in die Liste für den ersten Workshop – mit einem eigens engagierten Klimaforscher trugen sich genau 2 Personen ein.
Drei Beispiele aus dem kommunalen Alltag. Unterschiedlich und doch mit einer Gemeinsamkeit: Gut gemeinte Angebote werden nicht wahrgenommen. Unser Institut hat in allen drei Fällen die Ursachen analysiert. Sie waren ebenfalls divers, eine Gemeinsamkeit in allen Fällen war jedoch: Es fehlte bei den Zielgruppen an Betroffenheit.
Die aber ist immer subjektiv. Es hilft nichts, dass sie objektiv vorhanden ist. Betroffenheit muss wahrgenommen werden. Und das in einer Intensität, die einen Beteiligungsimpuls auslöst. Das kann mit gutem „Marketing“ intensiviert werden – aber nur in einem überraschend engen Rahmen.
In den geschilderten Beispielen war es eher ein strukturelles Problem: In allen drei Fällen wurden Zukunftsthemen aufgerufen. Auf den ersten Blick eine gute Idee. Doch wer interessiert sich für Dinge, die in einer Kommune in 20 oder gar 30 Jahren passieren? Nur jemand, der sich dann auch noch in dieser Kommune sieht.
Viele Jugendliche im Ruhrgebiet sehen heute ihre Zukunft überall – nur nicht da, wo sie jetzt leben. Viele Schichtarbeiter*innen bei Volkswagen in Wolfsburg sehen ihre Kommune nur selten bei Tageslicht. Und Senior*innen haben viele Themen, das, was 30 Jahre in der Zukunft spielt, gehört eher selten dazu.
Gemein ist allen drei Fällen also ein systemischer Irrtum, der gerade in der kommunalen Bürgerbeteiligung verlockend ist: Kommune als PERSPEKTIVISCHER Lebens- und interessenschwerpunkt existiert als Konzept nur für einen Teil der Bürger*innen.
In der Stadt Heidelberg ziehen zum Beispiel jährlich über 15.000 Menschen zu – und ungefähr gleich viele Leute weg. Das sind rund 10 % der Bevölkerung. Rechnerisch (nicht wirklich) tauscht sich die Bevölkerung also alle 10 Jahre aus. Dazu kommt gerade bei jungen Menschen eine Lebensplanung, die sie zukünftig nicht zwingend im Heimatort sieht. Ähnliches gilt für viele Bürger*innen anderer sozialen, ethnischen und beruflichen Altersgruppen. Dazu kommen noch jene, die sich aktuell in einer gesundheitlich, psychisch, beruflich oder finanziell schwierigen Situation befinden.
Lohnt es sich also gar nicht, Beteiligung anzubieten?
Natürlich lohnt es sich. Und es funktioniert ja auch jeden Tag in vielen deutschen Kommunen ganz ausgezeichnet. In vielen anderen wird Beteiligung sogar massiv eingefordert.
Die entscheidende Herausforderung ist, Beteiligung von einem idealtypischen „Kommune“-Konzept zu emanzipieren, das eine örtliche Bevölkerung als über Generationen weitgehend konstant und sich nur demografisch entwickelnd versteht. Das ist in weiten Teilen Deutschlands heute nicht mehr die Realität.
Für Beteiligungsangebote heißt das: Sie sind umso erfolgreicher, je mehr sie an den aktuellen Bedürfnissen der Menschen ansetzen. Nichts spricht gegen partizipative Zukunftsplanung. Sie muss nur bei den Themen beginnen, die die Menschen heute beschäftigen.
Gute Beteiligung ist immer Betroffenenbeteiligung. Und sie erreicht die Betroffenen nur, wenn sie das adressiert, was diese auch als Betroffenheit wahrnehmen.
Wenn das gelingt, dann werden Betroffene auch Beteiligte. Und darum geht es.








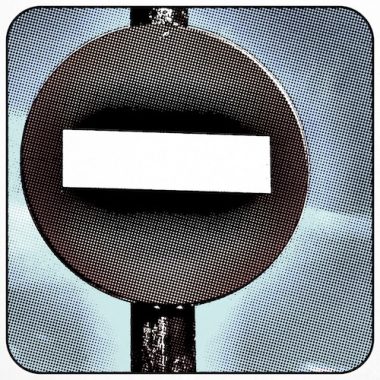
Sehr geehrter Herr Sommer,
es ist sicherlich einfacher Partizipationsmodelle zu entwerfen als die Bevölkerung zum Mitmachen zu begeistern. Bei den vielen Angeboten nur an die eigene Verwirklichung zu denken, bleiben die Inhalte für ein demokratisches Gemeinwohl auf der Strecke. Entweder durch eine Beschreibung von Win-Win-Modellen oder über örtliche Angebote die Inhalte einer Demokratie kennenzulernen könnte ich mir eine bewusste Stärkung der Partizipation für jedermann und der Demokratie vorstellen.
Lieber Herr Sommer, am Anfang jeder großen Vision steht eine einfache Idee, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte.
Vielleicht lesen Sie ja meinen Kommentar und melden sich bei Interesse.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Günther Hohn
Lieber Herr Hohn,
ich denke, das Problem des mangelnden Engagements für Gemeinwohl ist sehr komplex. Das Überangebot der „Konkurrenz“ spielte sicher rein, aber auch mangelnde Angebote, eine kompetitive Bildung- und Arbeitswelt, wenig Erfahrung mit positiven Wirkungsprozessen und viele mehr. Mehr Beteiligungsangebote sind da sicher hilfreich, ganz unabhängig von einzelnen Formaten. Neue Ansätze udn Konzepte sind da immer Interessent. Senden Sie Ihre Ideen doch am besten einfach an unser Institut, wegen der Gräber poste ich hier keine Mailadresse – aber dies ist der Link zu unserem Kontaktformular: https://www.bipar.de/kontakt-2/
Sehr geehrter Herr Sommer, seit einiger Zeit verfolge ich Ihre wöchentlichen Botschaften – mal nickend, mal kopfschüttelnd – zumeist aber angeregt zum Nach-Denken.
In diesem Fall möchte ich aber doch reagieren und einen Punkt zu Ihren Überlegungen hinzufügen, den ich schmerzlich vermisst habe: Vertrauen! (als Ursache für geringes Beteiligungsinteresse)
Was damit in diesem Zusammenhang gemeint ist mag folgender Praxisfall verdeutlichen: Zu einer Bürgerversammlung erschienen sehr viel weniger Teilnehmerinnen & Teilnehmer als erwartet. Der zuständige (lebenserfahrene) Dezernent fasste seine Beurteilung dieser Situation in einem Satz zusammen: „Da müssen wir ja Vieles richtig gemacht haben.“ In der Tat: Der Fall wurde im Vorfeld gut dargestellt und die lokale (politische) Atmosphäre war auch nicht durch vorgängige Skandale vergiftet.
Kurzum: Man vertraute der Verwaltung (und wohl auch den politischen Gremien) – und sah keine Notwendigkeit, selbst aktiv zu werden. Ist das nicht eigentlich ein Idealzustand – zumal in Zeiten, in denen Beteiligung oft (nach meinen Beobachtungen sogar überwiegend) „misstrauensgetrieben“ ist?
Freundliche Grüße
Klaus Selle
PS. Doch noch eine Nachbemerkung zum gelegentlich geringen Interesse an Zukunftsprozessen: Sie sind (nimmt man die Perspektiv-/Masterpläne etc. in der Stadtentwicklung als Beispiel) sehr oft „substanzlos“ – also: inhaltlich diffus, verbleiben auf der „Wünsch-Dir-Was“-Ebene, haben keine klaren Adressaten und erzeugen keine nachhaltigen Wirkungen (von aufwändigen Dokumentation und politischem Selbstlob abgesehen). Wer das einmal erlebt hat, wird sich kaum ein zweites mal der Mühe unterziehen.
Lieber Herr Selle,
vielen Dank für die Anmerkungen. Ihre Kritik an „substanzlosen“ Zukunftsprozessen kann ich gut nachvollziehen, sie sind oft gut gemeint, aber am Ende eher kontraproduktiv. Vor allem, wenn eine Wirksamkeit nicht erkennbar ist. Das Thema „Vertrauen“ habe ich bereits mehrfach im Newsletter diskutiert. Das Verhältnis von Vertrauen zu Beteiligung ist komplex. Und ja, umfangreiches Vertrauen, kann durchaus den Impulses ich zu beteiligen, unterdrücken. Aber es ist hier wie bei den schlechten Schulnoten und der Hochbegabung: fast alle Hochbegabten fallen erstmals auf, indem sie ind er Schule schlechte Noten abliefern. Doch der Umkehrschluss taugt nichts: Nicht jeder schlechte Schüler ist hochbegabt. In der Beteiligung heißt das: Nur weil die menschen kein Angebot wahrnehmen, müssen sie noch lange nicht Vertrauen haben. Sie können auch schlicht nichts davon wissen, keine Zeit haben, sich selbst keine Wirksamkeit zutrauen oder den Glauben an die beteiligende Institution so gründlich verloren haben, dass sie keinen Sinn in Engagement sehen. Vielleicht hat der zitierte Dezernent in Ihrem Fall wirklich Vieles richtig gemacht. Er sollte sich da aber nicht zu schnell zu sicher sein …
Herzlichst, Jörg Sommer