Ausgabe #109 | 3. Februar 2022
Liebe allein reicht nicht
„Ich liebe euch doch alle!“. Ein historisches Zitat. Erich Mielke, letzter Chef der Stasi in der untergehenden DDR, soll es gesagt haben. Der Mann, dessen Organisation jahrzehntelang Furcht und Schrecken unter Oppositionellen verbreitet hatte.
Und wieder einmal stimmt es nicht.
Zumindest nicht so ganz. Als er nämlich im November 1989 zum ersten und einzigen Mal eine Rede in der DDR-Volkskammer hielt, damals schon ein Übergangsparlament, sprach er nicht, sondern stammelte viel mehr, sichtlich überfordert.
Einer der mächtigsten Männer der alten DDR wurde von zahlreichen Delegierten verhöhnt. Menschen, die eine lange Zeit politischer Ohnmacht hinter sich hatten, verloren jeden Respekt vor den Akteuren der Obrigkeit.
In dieses Hohngelächter hinein stotterte er:
„Ich liebe – Ich liebe doch alle – alle Menschen – Na ich liebe doch – Ich setzte mich doch dafür ein!“.
Das Faszinierende daran ist: Ganz offensichtlich war er in diesem Moment viel zu aufgewühlt, um zu lügen. Er meinte das wirklich ernst.
So wie die anderen Mitglieder der DDR-Elite hatte er offensichtlich schon lange jeden Bezug zur Realität der einfachen Bürgerinnen und Bürger verloren. Abgeschottet in ihren Büros und ihren Häusern in der streng bewachten Waldsiedlung Wandlitz nahmen sie die Wirklichkeit nur noch gefiltert durch die Parteiorgane war.
Ein weiteres, eindrucksvolles Beispiel für die geschichtliche Erkenntnis: Wenn die Herrschenden keine freie Presse zulassen, belügen sie sich vor allem selbst.
Das geht um so leichter, je ungleicher die Macht in einer Gesellschaft verteilt ist.
In Diktaturen ist es offensichtlich. Doch auch in Demokratien haben wir latent mit dem Phänomen zu kämpfen, das die Grundlage für die besondere drastischen Wahrnehmungsunterschiede ist. Wie jene, die wir zum Ende der DDR hin beobachten konnten.
Berufspolitiker*innen und Bürger*innen leben in verschiedenen Wirklichkeiten. Besser formuliert: Sie nehmen dieselben Prozesse, Strukturen, Entwicklungen und Entscheidungen unterschiedlich war.
Das ist keine Charakterschwäche von Politiker*innen. Es ist ein systemisches Problem. Es ist auch nicht primär eine Frage unterschiedlicher Lebensstandards oder abgeschotteter Arbeits- und Wohnsituationen.
Tatsächlich können selbst häufige und intensive Kontakte zwischen Politiker*innen und Bürger*innen per se dieses Problem nicht beheben. Weder Parlamentsbesuche noch Bürger*innensprechstunden schaffen es aus der Welt. Und auch die Tatsache, dass wir in Deutschland eine freie und oft ungnädige Presse haben, hilft nicht.
Wir erleben es gerade bei den Corona-„Spaziergängen“, lesen es täglich auf Twitter und Facebook, kennen es aber auch aus diversen Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen zum Leitungsbau oder beliebigen anderen Maßnahmen: Hass, Zorn und wüste Beschimpfungen gegenüber Politiker*innen nehmen zu, das gilt auch für Morddrohungen und reale Übergriffe.
Verglichen damit ist Erich Mielke damals noch recht glimpflich davongekommen.
Politiker*innen, häufig auch ehrenamtliche kommunalpolitisch Aktive, haben für Teile der Bevölkerung jedes Verständnis verloren – und umgekehrt.
Gerade in der Kommunalpolitik steigt der Frust.
Viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte machen diesen Job, weil sie ihre Kommune lieben, die Menschen mögen, das Zusammenleben trotz häufig knapper Kassen gestalten wollen. Sie opfern Tag für Tag ihre kostbare Freizeit, suchen Kompromisse, ertragen Frustrationen – doch kaum jemand honoriert das.
Die Menschen, für die sie aktiv sind, melden sich nur bei ihnen, wenn sie etwas zu kritisieren haben – dann aber richtig. Richtig sauer, richtig heftig und manchmal auch richtig fies. Die entscheidende Frage lautet: Warum?
Warum mühen die einen sich ab, erfahren aber weder Anerkennung noch Respekt? Warum können die anderen die Ergebnisse politscher Prozesse zunehmend weniger akzeptieren?
Erklärungen dafür gibt es viele: Zunehmende Individualisierung, und Entsolidarisierung, der Bedeutungsverlust von Gemeinwohl gegenüber Partikularinteressen, die Verrohung der Sprache in den (a)sozialen Netzwerken. All diese Themen haben wir auch schon in unserem Newsletter diskutiert.
Doch es gibt noch einen weiteren Faktor. Er wird gerne übersehen, ist aber durchaus nicht unbedeutend: Die demokratische Resilienz des Einzelnen.
Das ist etwas anderes als die Resilienz der Demokratie – dort geht es um die Widerstandsfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft als Ganzes.
Die demokratische Resilienz eines jeden von uns ist ein wichtiger Teil deren Basis. Sie beschreibt, wie sehr wir uns „demokratisch verhalten“ können. Und zwar genau dann, wenn es nicht nach unserem persönlichen Willen geht.
Demokratie ist etwas Wunderbares, solange man zur Mehrheit gehört. Sie ist eine Herausforderung, wenn wir in der Minderheit sind.
Es geht also vor allem um die Frage, ob wir in der politischen Meinungsbildung „verlieren“ können.
Diese Fähigkeit ist jedoch nicht angeboren. Sie muss erlernt werden. Und wie bei allen Fähigkeiten hilft dabei nur eines: Training.
Football-Spieler verbringen einen großen Teil ihres Trainings damit, sich niederstrecken zu lassen. Das ist keine Fähigkeit, die man unmittelbar zum Sieg braucht – aber die einen im Spiel resilient gegen solche Attacken macht. Nur so hält man Spiele durch und gewinnt Meisterschaften.
Und genau hier driften die Erfahrungen von Mandatsträger*innen und Bürger*innen gewaltig auseinander: Während letztere quasi keinerlei Erfahrung mit politischen Prozessen haben, trainieren Politiker*innen permanent.
Vor allem lernen sie dabei in einer Demokratie: Kompromisse zu machen, kleinste Fortschritte zu feiern und regelmäßig mit Niederlagen und Frustrationen umzugehen. So gut wie nie erreichen sie ihre Ziele umfassend, setzen sie 100 Prozent ihrer Positionen durch.
Kurz und gut: Wer auch nur wenige Jahre in der Politik verbracht hat, hat gelernt, zu verlieren ohne zu verzweifeln. Und er oder sie neigt dazu, zu übersehen, dass die Wählerinnen und Wähler diese unmittelbaren Erfahrungen nicht machen konnten – höchstens medial verfolgen.
Und von einem 140 Kilo Koloss auf dem Football-Feld umgemäht zu werden ist definitiv eine andere Erfahrung, als vor dem Fernseher dabei zuzuschauen.
Wir haben also zwei systemische Ursachen, die auch und gerade in einer Demokratie für eine latente Entfremdung von Politik und Bürgerschaft sorgen: Die einen haben wenig Möglichkeit, Diskurs, Kompromiss und Niederlage einzuüben, die anderen wenig Chancen, dies zu beherzigen.
Man müsste eine Methode erfinden, um diese Defizite zumindest teilweise auszugleichen.
Doch halt. Wir haben sie ja schon.
Genau aus diesem Grund arbeiten wir ja daran, die Bürgerbeteiligung in Deutschland weiterzuentwickeln. Genau in diesen Prozessen können wir miteinander die Fähigkeiten trainieren, die es in politischen Prozessen braucht. Wir können erkennen, dass es nie nur unsere Wahrheit gibt. Wir können Selbstwirksamkeit erfahren und deren Grenzen erleben.
Und genau das macht uns resilient.
Es ist die wohl am meisten unterschätzte Wirkung von Beteiligung: Die Fähigkeit, sich nicht durchzusetzen, ohne zu resignieren oder sich zu radikalisieren.
Jetzt müssen wir nur noch eine Idee entwickeln, wie wir den politisch Verantwortlichen Gelegenheit geben, mögliche Wahrnehmungsverzerrungen zu vermeiden.
Und siehe da: Auch hier bietet dieselbe Bürgerbeteiligung die Chance.
Schon eine einzige intensive Mitarbeit in einem Beteiligungsprozess kann ungeheuer erden. Auch hier gilt wie beim Football-Training: Je öfter, desto besser.
Das erfordert jedoch die Bereitschaft, sich diesem unangenehmen Training auch auszusetzen. Wer sich als Mandatsträger*in damit begnügt, Beteiligung zu beauftragen und die Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen, der vergibt eine großartige Chance.
Denn Liebe allein reicht nicht. In keiner Beziehung. Auch nicht in der zwischen Wähler*innen und Gewählten. Man muss an ihr arbeiten. Auch wenn es weh tut.
Gerade dann.
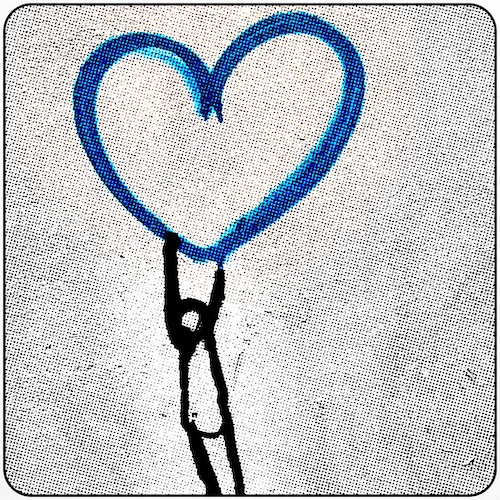







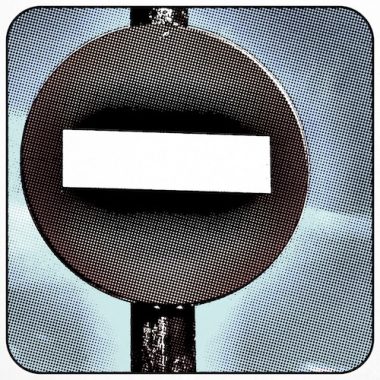
Sehr geehrter Herr Sommer,
Ihre Analysen und Betrachtungen mit diversen Lösungsungsansätzen finde ich sehr lobenswert. Was mir allerdings fehlt sind Ihre Vorschläge für konkrete Konzepte wie man Bürgerbeteiligung bürgernah für jedermann zugänglich implementieren kann. Zu diesem Thema habe ich Ihnen schon mehrfach ein neues Konzept signalisiert, das ich gerne mit Ihnen erörtern würde, da es gut zu Ihrer Vita passen würde.
Wenn Sie mein Kommentar erreichen sollte, würde es mich freuen von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Günther Hohn