Ausgabe #115 | 17. März 2022
Die digitale Falle
Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie sind noch lange nicht ermittelt. Wir wissen aber schon jetzt, dass zum Beispiel ganze Jahrgänge von Kindern keine Schwimmkurse besuchen konnten, keine Bibliothekseinführungen erlebten, Defizite im Lesen und Schreiben aufweisen. Auch in weiteren Lebensbereichen kam es mit dem ersten Lockdown zu einer Vollbremsung. Und viele haben sich davon bis heute nicht erholt.
Andererseits gab es wichtige Impulse. Viele Beschäftigte – und viele Vorgesetzte – haben die Vorteile der Remote-Arbeit kennen und schätzen gelernt. Viele Schulen und Behörden bemühen sich nun ernsthaft um eine seriöse Digitalisierung. Die meisten haben dafür nun auch erstmals Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt also Licht und Schatten.
Zumindest der Digitalisierungsimpuls bietet eine Chance, auch für die demokratische Teilhabe. Könnte man glauben. Sollte man aber nicht. Denn die Covid-19-Bilanz fällt in Sachen Demokratie eher ernüchternd aus.
Die Pandemie führte zu einem abrupten k.o. für unzählige Beteiligungsprozesse im ganzen Land, wie schon Anfang 2020 eine Studie des Berlin Institut für Partizipation ermittelte.
Da bis vor wenigen Jahren Beteiligung weit überwiegend analog gedacht und organisiert wurde, gab es – ähnlich wie im Bildungswesen – in der Fläche zu wenig Erfahrung und zu wenig Ressourcen, um aus dem Stand in die digitale Welt „umzuziehen“.
So kam es zu einem erheblichen Abbruch von Dialog. Ausgerechnet in einem Moment, in dem drastische Eingriffe in Bürgerrechte erfolgen mussten.
Zusätzlich erlebten Familien heftige Belastungen durch geschlossene Schulen und Betreuungseinrichtungen, aber auch durch die Isolation von Großeltern und durch Homeoffice-Situationen in räumlicher Enge. Dazu kamen unmittelbare wirtschaftliche Existenzängste für einen erheblichen Teil der Bevölkerung.
Gerade in einer solchen Phase, in der ein Dialog zwischen politischen Entscheider*innen und Bürger*innen intensiver denn je nötig gewesen wäre, kam es nun auch zu einem Abbruch der „dialogischen Beziehungen“.
Nur in ganz wenigen Kommunen gelang es, unter diesen schwierigen Bedingungen weiter Dialoge gerade zur Pandemie und den Maßnahmen selbst zu ermöglichen.
Dass unsere Gesellschaft durch diese Entwicklung Wunden davongetragen hat, aber nicht so auseinandergefallen ist, wie manche Akteure jenseits des demokratischen Spektrums es gerne gesehen hätten, ist letztlich ein Beleg für die oft unterschätzte Resilienz unserer Demokratie.
Doch Wunden bleiben Wunden. Sie schmerzen nicht nur, sondern heilen längst nicht immer von allein.
Tatsächlich haben wir in der politischen Teilhabe mehr als ein „verlorenes Jahr“ zu verzeichnen, wie die am vergangenen Dienstag veröffentlichte Folgestudie des Berlin Institut für Partizipation recht eindeutig ergeben hat.
Ebenso eindeutig ist aber auch ein starker Impuls zur Digitalisierung zu beachten.
Nahezu in jeder beteiligenden Kommune wird über digitale Tools zumindest nachgedacht, in vielen werden sie bereits erprobt oder entwickelt. Und das geht in der Regel deutlich über die Nutzung von Videokonferenz-Systemen hinaus.
Mit dieser Digitalisierung sind viele Hoffnungen verbunden.
Digitale Beteiligung kann mehr Menschen einbeziehen, neue Gruppen erreichen, schneller Ergebnisse produzieren, Beteiligungskultur resilienter machen, weniger Aufwand für die Verwaltung bedeuten, besser in politische Prozesse eingespeist werden und dabei noch deutlich kostengünstiger sein.
Sie kann das alles bedeuten. Und nichts davon.
Ein bekannter Telekommunikationsmanager sagte einmal: „Wenn Sie einen schlechten Prozess digitalisieren, haben Sie einen schlechten digitalen Prozess.“
Tatsächlich ist die digitale Transformation von politischer Teilhabe doppelt so herausfordernd, wie die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen: In beiden Fällen gilt zwar: Was analog schon schlecht funktionierte, funktioniert digital nicht besser.
Denn alle Herausforderungen Guter Beteiligung gelten auch im digitalen Raum. Ob transparente Information, breite Beteiligung, wertschätzender Umgang, valide und wirksame Ergebnisse. Nichts davon funktioniert plötzlich besser, weil die Prozesse nun digital sind.
Doch dazu kommt noch: Manche Formate lassen sich schlicht nicht digitalisieren. Die wichtigen informellen Gespräche im Rahmen von Beteiligungssituationen finden in Videokonferenzen nicht statt. Die Erarbeitung von Vertrauen gelingt den meisten nur bei realer Anwesenheit im selben Raum.
Digitalisierung von Teilhabe heißt also nicht nur Digitalisierung bewährter Prozesse und Formate, sondern Entwickelung neuer, digital wertiger Methoden – und die kluge Verknüpfung von beidem.
Die aktuelle Digitalisierungsstudie des bipar belegt, dass genau diese Herausforderung den meisten Akteuren durchaus bewusst ist.
Was heißt das für die Praxis?
Es fordert ein kurzes Innehalten. Spontan in der Krise entwickelte digitale Methoden sollten nicht einfach fortgeführt werden, nur weil sie in einer Zeit funktionierten, in der es schlicht keine analogen Angebote gab.
Zwei Schritte zurück sind angebracht: Am Anfang sollte eine offene Analyse der bisherigen Beteiligungspraxis stehen. Ob Eigen- oder Fremdevaluation hängt von den Ressourcen ab.
Wichtig ist Klarheit darüber, wie es um die Beteiligungspraxis in der Kommune oder der Institution bestellt ist. Was funktioniert gut, was weniger, wer wird erreicht, wer beteiligt sich nicht. Wie sieht es mit der Wirksamkeit aus?
Nur wer genau weiß, was er analog tut, kann ermitteln, was davon er nun auch oder alternativ digital umsetzt – oder was gegebenenfalls digital neu gestaltet wird.
Und dann, wirklich erst dann, macht es Sinn, sich digitale Beteiligungsplattformen wie CONSUL, DECIDIM oder gar individuell erstellte Tools zuzulegen. Die Faustregel lautet also: Keine Digitalisierung ohne Evaluation.
Und für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen, gibt es ein Add-on: Die Digitalisierung von Beteiligung selbst als Beteiligungsprozess zu verstehen.
Warum nicht die Menschen fragen, welche digitalen Teilhabeangebote sie wirklich wollen, brauchen, nutzen – und deren Entwicklung in einem dialogischen Prozess gemeinsam begleiten?
Denn ein solcher Prozess ist immer ein Lernprozess. Und Lernen geht nun einmal gemeinsam am besten.
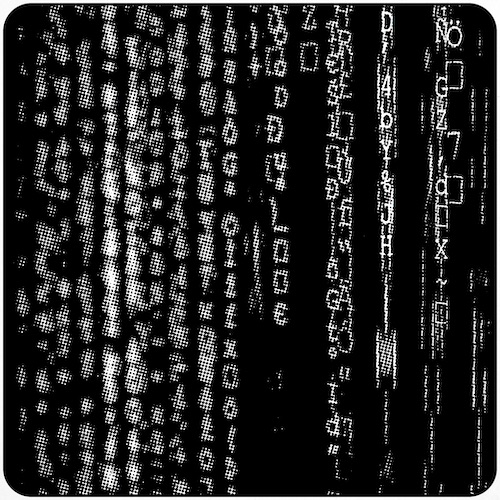








Vielen Dank fürs Teilen der Studie.
„Beteiligungslücke“ – Interessant ist es, bei dieser Frage die Perspektive der Teilnehmenden einzunehmen. Überraschend war, dass digitale Beteiligungsformate mehr Menschen erreichen können und vor allem jene, die früher nicht ins Rathaus oder in die Stadthalle kamen und dass die Schwellen, sich zu Wort zu melden, gesenkt wurden. (Brettschneider, F. „Das Empfinden der Teilnehmenden – ein Dialog über die Evaluation von Online-Partizipation“ in Luppold et.al. (2021): „Berührende Online-Veranstaltungen“, S. 157 ff). Unbedingt unterstütze ich den Vorschlag, digitale Teilhabeangebote in einem dialogischen Prozess gemeinsam zu entwickeln bzw. begleiten zu lassen. Das werden wir brauchen, wenn wir wirklich partizipative hybride Formate (örtlich und zeitlich) entwickeln und testen werden.