Ausgabe #141 | 15. September 2022
Die Gemeinwohlfalle
Bürgerbeteiligung löst Konflikte. Das ist ein beliebtes Missverständnis. Beliebt auch deshalb, weil es manchmal wirklich funktioniert.
Oder zumindest so aussieht.
Habe ich Sie genügend verwirrt? Dann tun wir vielleicht einmal mehr das, was in solchen Fällen stets hilft:
Wir werfen einen Blick in die Praxis.
Konkret in eine mittelgroße süddeutsche Kommune. Von denen gibt es Einige. Und viele verbindet eine ähnliche Situation: Deutlich zu wenig Wohnraum und eine in Teilen durchaus einkommensstarke Einwohnerschaft.
Auch in unserem Beispiel war das so. Also plante die Kommune ein Neubaugebiet von beträchtlichem Ausmaß. Wegen der schieren Größe sollte es in drei Teilen erschlossen werden.
Zwei Teile davon mit Fokus auf die beliebten Einfamilienhäuser mit Garten und Bahnhofsnähe.
Etwas weiter weg vom Bahnhof, dafür näher an einer stark befahrenen Bundesstraße sollte später ein dritter Teil dazukommen:
Mit Mehrfamilienhäusern und zu einem kleinen Teil sozialem Wohnungsbau. Als integrierter Lärmschutz für die Einfamilienhaussiedlung. Eine typisch clevere schwäbische Lösung.
Dachte man.
Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf. Der erste Teil war realisiert, der zweite Teil mitten im Bau. Da gründete sich eine Bürgerinitiative gegen die dritte Ausbaustufe.
Die Motive der Akteur*innen waren unterschiedlich. Zu viel Verkehr befürchteten die einen, ein neues „Problemviertel“ wollten die anderen verhindern. Da zwischenzeitlich auch einige Gemeinderät*innen im neuen Ortsteil wohnten, gewann die Sache rasch an Brisanz.
Die Kommune reagierte und startete einen Beteiligungsprozess mit den Betroffenen. Also den Anwohner*innen.
Die Deliberation dauerte, der Ton wurde auch mal giftig, doch am Ende stand eine Lösung, mit der letztlich nahezu alle Beteiligten zufrieden waren.
Die dritte Ausbaustufe unterblieb. Dafür gab es eine Lärmschutzwand an der Bundesstraße.
Der Konflikt wurde beigelegt, der soziale Frieden wiederhergestellt. Betroffenenbeteiligung at it’s best.
Nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt, tatsächlich an der gleichen Bundesstraße, donnerten weit über 10.000 PKWs Tag für Tag durch einen Ort. Ein großer Teil davon waren LKWs. Jahrelang kämpften Anwohner*innen gegen Lärm und Abgase.
Letztlich wurde im Rahmen eines mustergültig partizipativen Planungsprozesses eine Lösung gefunden.
Für eine hohe zweistellige Millionensumme wurde eine Umgehungsstraße realisiert.
Zwei Dutzend Familien wurden so dauerhaft entlastet. Die Immobilienwerte stiegen dramatisch. Darunter auch für zwei Mietshäuser, die ein Investor in Erwartung der Wertsteigerung erst kurz zuvor erworben hatte.
Dafür wurden zwei kleinere Ortsteile vom Zentrum abgetrennt, ein Wald durchschnitten und, weil nun ja gut erreichbar, ein Gewerbegebiet erschlossen. Insgesamt wurde eine Fläche neu be- und zersiedelt, die der Hälfte des Kernortes entsprach.
Beide Beispiele zeigen uns: Gut gemachte Betroffenenbeteiligung kann Konflikte lösen. Besonders gut gelingt dies, wenn man einen Teil der Betroffenen nicht beteiligt.
Im ersten Fall sind die Anwohner*innen glücklich. Jenen, die dringend bezahlbare Mietwohnungen benötigen, ist aber nicht geholfen.
Im zweiten Fall wurde mit viel Geld wenigen Betroffenen Erleichterung verschafft. Andere Bewohner*innen, die Natur und mit ihr kommende Generationen dürfen die Lösung ausbaden.
Beiden Beteiligungsprozessen ist eines gemein: Sie suchten Lösungen für jetzt und für eine begrenzte – beteiligte – Gruppe.
Das Gemeinwohl? War kein Thema.
Nun ist es so eine Sache mit diesem Gemeinwohl. Der Begriff ist schwammig, die Definitionen sind vielfältig. Am ehesten lässt sich Gemeinwohl noch definieren als Gegenbegriff zu bloßen Einzel- oder Gruppeninteressen innerhalb einer Gemeinschaft.
Gerade deshalb ist Gemeinwohl eine wichtige Perspektive, wenn es um Beteiligung geht. Denn da ist die Sache ein wenig vertrackt.
Wir haben gesehen, dass Beteiligung von unmittelbaren Betroffenen wichtig ist, aber schnell dazu führen kann, dass die Interessen der nichtbeteiligten Betroffenen (Und die gibt es faktisch immer) auf der Strecke bleiben.
Um so interessanter scheint die Idee, ausschließlich Nichtbetroffene zu beteiligen.
Losbasierte Bürgerräte sind so ein Format. Sie sind für vieles geeignet. Aber tatsächlich entsteht auch hier nicht automatisch Gemeinwohl. Wenn es die Perspektiven bestimmter Betroffenengruppen nicht mit ins geloste Panel schaffen, besteht auch hier das Risiko, dass sie unberücksichtigt bleiben.
Ob Klima, Tier- oder Pflanzenreich, ob zukünftige Einwohner*innen oder zukünftige Generationen: Alle Entscheidungen, die wir heute treffen, haben Folgen für Unbeteiligte.
Die Idee, Gemeinwohl würde quasi automatisch entstehen, wenn zwei oder mehr Parteien ihre Interessen verhandeln, ist zwar praktisch, aber absurd.
Beteiligung generiert nicht automatisch Gemeinwohl. Ebenso wenig wie direktdemokratische Abstimmungen oder Wahlen. Tatsächlich ist keine der drei Säulen einer Vielfältigen Demokratie ein Gemeinwohlgarant.
Die Chance auf gemeinwohlorientierte Ergebnisse ist allerdings höher, je intensiver eine Vernetzung aller drei Säulen (Deliberation, Direktdemokratie, repräsentative Strukturen) stattfindet.
Davon sind wir in Deutschland noch ein ganzes Stück entfernt.
Doch auch auf dem Weg dahin können wir uns schon verbessern. Wir könnten über innovative Lösungen nachdenken, sogar über disruptive.
Aktuell gewinnt zum Beispiel eine Initiative an Zuspruch, die der Natur eine eigene Rechtspersönlichkeit zubilligen will. Dann könnte die Isar die Stadt München verklagen, oder die malträtierten Schweine die Firma Tönnies. Spannend, das praktisch zu durchdenken.
Andere Vorschläge betreffen die kommenden Generationen, denen wir nach wie vor Tag für Tag Lebensperspektive rauben.
Da gibt es die Idee, zukünftig alle politischen Entscheidungen unter Zustimmungsvorbehalt eines zufallsbesetzten „Rates der Jungen Generation“ zu stellen.
Oder gleich das Wahlrecht zu ändern und Menschen ab Geburt nicht nur eine, sondern 100 Stimmen zu geben – und anschließend für jedes Lebensjahr eine Stimme abzuziehen.
Klingt etwas verrückt? Gut. Fangen wir bei den Strukturen an, die wir haben.
In der Rahmensetzung für Beteiligungsprozesse könnte das Primat des Gemeinwohls fixiert sein, zum Beispiel in Leitlinien oder per Gemeinderatsbeschluss. Die Ausrufung eines „Klimanotstands“, wie ihn manche Kommunen schon vollzogen haben, geht in eine solche Richtung.
Bei der Besetzung von Beteiligungsprozessen gehört immer auch die Frage auf den Tisch: Welche Akteursgruppe könnte den Gemeinwohlfokus intensivieren? Zumindest aber gelten als betroffen eben nicht nur jene, die vom Problem betroffen sind, sondern auch jene, die von den Lösungen betroffen sein könnten.
Und letztlich sollte eine Frage immer und in jedem einzelnen Fall bei der Bewertung von Beteiligungsergebnissen gestellt werden. Und das besser im Prozess (zum Beispiel durch die Moderation) als danach:
„Cui bono?“
Also: Wem nützt es? Und zu welchem Preis? Und auf wessen Kosten?
Gut. Das sind jetzt drei Fragen.
Aber sie lohnen sich. Denn bei allen demokratischen Prozessen geht es eben am Ende immer genau um diese Abwägungen: Was investieren wir, was tun, aber auch: was lassen wir – und wem kommt das letztendlich zugute?
In einer Demokratie geht es um handfeste Partikularinteressen. Das Ziel ist, aus diesen Gemeinwohl zu generieren.
Das aber findet in keinem dieser Prozesse, ob in Parlamenten, Wahlkabinen oder Bürgerversammlungen, von allein statt.
Sondern nur dann, wenn man darüber spricht.

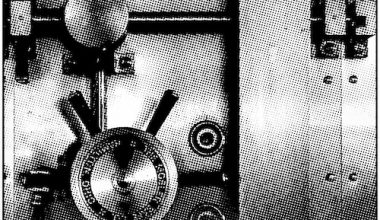







Danke für diesen wertvollen Beitrag! Sie nennen so wichtige Fragen – die leider so oft ignoriert werden! „Wem nützt es? Und zu welchem Preis? Und auf wessen Kosten?“
Nur den Titel finde ich verwirrend / irreführend. Führt uns das echte Gemeinwohl in die Falle? Ich denke nur das vermeintliche Gemeinwohl, das in Wirklichkeit ein „Partikular-Wohl“ ist, tut es.
Und wenn wir unser Grundgesetz ernst nehmen, ist dort das Gemeinwohl bereits mit verankert:
„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich DEM WOHLE DER ALLGEMEINHEIT DIENEN.“ (Art 14 (2)). Nehmen wir es ernst!