Ausgabe #148 | 3. November 2022
Innovation nach Plan?
Bitte denken Sie nicht nach, antworten Sie spontan: Welches Produkt fällt Ihnen ein, wenn Sie an Kaugummi denken?
War es Spearmint? Doublemint? Juicy Fruit? Hubba Bubba? Orbit? Airwaves? Skittles?
Egal, was Sie kauen. Die Chance ist groß, dass es ein Produkt der Firma Wrigley ist. Die oben Erwähnten sind es alle. Und noch viele, viele mehr.
Wrigley ist der größte Kaugummi-Hersteller der Welt.
Das war nicht immer so. Als William Wrigley Jr. 1891 in Chicago seine Firma gründete, stellte sie vor allem ein Produkt her: Seife.
So ziemlich das Letzte, was man sich in den Mund schieben würde.
Doch der Firmengründer war ein innovativer Unternehmer. Um sich im harten Seifen-Business bei seinen (vorwiegend) Kundinnen ins Gespräch zu bringen, legte er jeder Seife ein kleines Give-away bei.
Ein Päckchen Backpulver.
Das förderte den Seifenabsatz enorm. Wrigleys Backpulver war beliebt. So beliebt, dass Wrigley ins Backpulvergeschäft einstieg.
Um auch hier den Absatz zu fördern, kam das Unternehmen auf die Idee, jeder Verkaufseinheit Backpulver ebenfalls wieder ein Give-away beizulegen: zwei Streifen Kaugummi.
Das lief so gut, dass Wrigley ins Kaugummigeschäft einstieg.
Knapp 30 Jahre nach der Gründung einer kleinen Seifenfirma war Wrigley der erfolgreichste Kaugummiproduzent der Vereinigten Staaten, bald schon der Welt.
2008 wechselte das Unternehmen für damals 23 Milliarden Dollar den Besitzer.
Der Weg von der Seifenklitsche zum Multimilliarden-Unternehmen war untypisch. Denn in nur einer Generation gleich zweimal das Produktportfolio und die Branche komplett zu ändern, ist etwas, was heutigen Stromlinien-Manager*innen nicht in den Sinn kommen würde.
Da löst schon der bloße Wechsel von Antriebstechnik in Automobilkonzernen schiere Panik aus – obwohl der am Ende fast ein halbes Jahrhundert benötigen wird.
Innovation entsteht in der Wirtschaft traditionell eher nicht, indem sich Unternehmen dramatisch verändern, sondern durch Gründung neuer Unternehmen mit neuen Konzepten.
Die zwingen dann manchmal auch die Platzhirsche zur Transformation. Oft gelingt das nicht. Dann verschwinden die alten und die neuen dominieren den Markt.
In demokratischen Parteienlandschaften funktioniert das ganz ähnlich.
Umweltthemen hatten in Deutschland keinen Platz in den Parteiprogrammen – bis die GRÜNEN kamen. Als die SPD ihren Arbeitnehmerfokus verlor, kam die LINKE in die Parlamente. Und die Zentrierung der CDU wurde mit der Gründung der AfD quittiert.
Zwar sind die Zusammenhänge auf dem „demokratischen Markt“ etwas komplexer als in der Wirtschaft. Aber der Blick in europäische Nachbarländer zeigt, dass nicht veränderungsfähige Parteien rasch in die Bedeutungslosigkeit abrutschen können.
In Frankreich wurden die Sozialisten in wenigen Jahren faktisch pulverisiert, in anderen Ländern andere Parteien – mit zum Teil über hundertjähriger Historie.
Auch in Demokratien beruhen grundlegende Veränderungen häufig auf Disruption. Institutionen verlieren an Funktionen, Akteure an Zuspruch, Prozesse an Akzeptanz.
Und auch wenn es sich für Betroffene so anfühlt: Das sind nicht zwangsläufig „Unfälle“, erst recht kein Systemversagen.
Die größte Stärke einer demokratischen Struktur ist es, solche fundamentalen Veränderungen zu ermöglichen. Das unterscheidet sie eben von autokratischen Regimen, die nur an der Zementierung des Status quo Interesse haben.
Wechsel, Innovation, Veränderung – ist die Kernkompetenz der Demokratie.
Das funktioniert nicht immer, schon gar nicht immer sozialverträglich, auch nicht immer gewaltfrei und ohne Konflikte schon gar nicht.
Aber: „Changeprozesse“, wie wir heute gerne sagen, sind in Demokratien möglich. Und damit eine Anpassung an veränderte Bedingungen ohne einen gesellschaftlichen Kollaps.
Angesichts dessen, was uns an notwendigen Transformationen allein aufgrund der drohenden Klimakatastrophe noch erwartet, liegt die Vermutung nahe, dass uns noch mehr „change“ bevorsteht, als wir uns aktuell vorstellen können.
Das ist einer der Gründe, aus dem wir aktuell zahlreiche partizipative Prozesse etablieren.
Weil wir wissen, dass sich nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere Demokratie verändern muss, um zu bleiben.
Das ist gut. Und doch neigen wir dazu, auch diese neuen, partizipativen Strukturen mit demselben Denken zu planen, das in Wirtschaft und Gesellschaft Innovation so schwierig macht.
Ob aktuell trendige Bürgerräte oder andere Beteiligungsangebote: Erwartet werden innovative Ergebnisse – angeboten werden durchgeplante Prozesse.
Und wenn in diesen Prozessen dann Frustration und Konflikte entstehen, hören wir allzu oft, dass das „Erwartungsmanagement“ nicht funktioniert habe. Die Beteiligten hatten dann schlicht „falsche Erwartungen“.
Die Zahl der Prozesse, in denen solche Debatten aufkommen, ist erstaunlich hoch. Dabei wäre das durchaus vermeidbar, durch einige recht einfache Maßnahmen.
Die Wichtigste lautet: Wenn kein Interesse an innovativen Ideen besteht – dann gibt es auch nix zu beteiligen.
Soll es Innovation geben, dann braucht es ein Beteiligungsdesign, das nicht nur ergebnisoffen ist, sondern auch methodenoffen.
Innovation entsteht nie nach Plan.
Methoden in ehrlich innovationsinteressierten Beteiligungsformaten sind immer nur Angebote, nie Korsett.
Gerade dann, wenn sich der gewünschte Spirit bildet, wenn gemeinsames Denken außerhalb der ausgetretenen Pfade entsteht, können unpassende, im Vorfeld am grünen Tisch (oder in der Dienstleisterausschreibung) geforderte Formate lähmen.
In großen, komplexen, anspruchsvollen Verfahren ist die Gefahr durchgeplanter Prozesse tatsächlich noch präsenter. Zum einen, weil großer Ressourceneinsatz uns zu umfangreicheren Festlegungen verführt. Zum anderen, weil in solchen Verfahren oft nicht nur eine einzelne Methode zur Disposition steht, sondern möglicherweise auch ganze Verfahrensteile bis hin zu Formaten und Inhalten von Zwischen- und Endergebnissen.
Erst vor einigen Wochen durfte ich den Prozess eines „Verbrauchergutachtens“ moderieren. Ausgeloste Kund*innen sollten Forderungen zu „umweltfreundlichen Verpackungen“ formulieren.
Das war der Plan.
Doch schon nach den ersten zwei Kreativformaten war zu erkennen: Da war entschieden mehr drin. Also verhandelten wir unseren Prozess neu. Wir wählten andere Formate. Und wir erweiterten die Themen.
Am Ende stand die gemeinsame Erkenntnis, dass allein politische Forderungen zu kurz greifen und stattdessen nur ein Gestaltungsdreieck aus Politik, Wirtschaft und Kund*innen nachhaltige Transformation sicherstellen kann. Und dass das Zusammenwirken aller drei Akteure auf einer Kombination aus Rahmensetzung und Vorteilsgenerierung gründen muss.
Der darauf basierende Maßnahmenkatalog wurde am Ende ebenso lang wie innovativ.
Weder der Prozess noch das Ergebnis waren so geplant. Doch Beteiligte und Beteiligende haben gemeinsam gelernt und Innovation zugelassen.
Dieses Lernen im Verfahren nicht als Unfall, sondern als Leistung zu betrachten, haben wir in großem Maßstab erstmals in der deutschen Endlagersuche eingeführt.
Als ich damals in der entsprechenden Kommission den Begriff des „Lernenden Verfahrens“ verwendete, konnten sich die meisten Akteure darunter wenig vorstellen. Zwei Jahre später fand der Begriff sogar Eingang ins Gesetz.
„Lernendes Verfahren“ meint vor allem eines: nicht nur die Möglichkeit zuzulassen, dass der Prozess sich anders ausgestaltet als geplant. Sondern fest davon auszugehen, dass dies so sein wird.
In der Endlagersuche haben wir gar ein eigenes Gremium installiert, das genau solche Veränderungen thematisieren soll. Das braucht es in kompakteren Verfahren nicht.
Dort reicht es, den Prozess und die Methoden nicht zu zementieren, sondern dann modifikationsbereit zu sein, wenn es entsprechende Impulse gibt.
Diese Impulse sind übrigens nicht zu übersehen: Sie manifestieren sich immer als Konflikte.
Diese können laut sein oder leise. Teilnehmerschwund, Motivationstäler, Pausen, in denen mehr gesprochen wird als im Plenum – all das deutet darauf hin, dass der Prozess sich den Beteiligten anpassen muss.
In der Beteiligung gilt deshalb, wie auch in den klassischen demokratischen Prozessen: Jeder Konflikt birgt eine Lernchance.
Wir nutzen sie nur selten, das stimmt.
Aber die große Stärke demokratischer Kultur ist: Sie generiert solche gemeinsamen Lernchancen am laufenden Band.
Die wirkliche Herausforderung ist, sich darauf einzulassen.








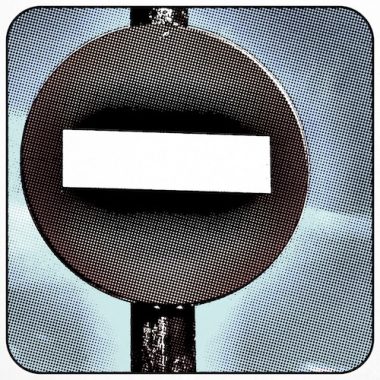
Danke für diesen Text! Ich stimme Ihnen zu, mit der kleinen Einschränkung, dass der Begriff innovativ oder auch Innovation häufig verwendet wird, obwohl kaum wirkliche Veränderung folgt.