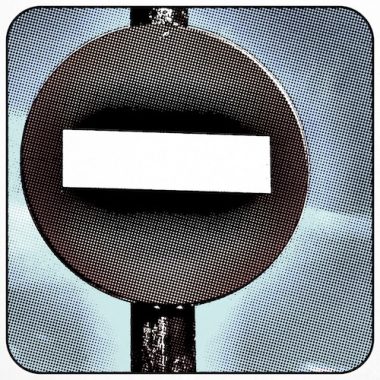Ausgabe #116 | 24. März 2022
Lob des Irrtums
Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die bereits in frühester Jugend echte Selbstwirksamkeit erfahren durften. Noch vor meiner Volljährigkeit war ich Schülersprecher, Chefredakteur einer Schülerzeitung, Programmchef eines lokalen Jugendkinoprojektes und Spitzenfunktionär eines sozialdemokratischen Jugendverbandes.
Ich war kurz davor, mich hauptberuflich für eine politische Karriere zu entscheiden und sollte jüngster Landtagskandidat meiner Partei werden. Im entscheidenden Gespräch mit den lokalen Parteigrößen fiel dann der Satz, der meine Karrierepläne gründlich auf den Kopf stellen sollte.
Es war ein Lob. Aber eines von der Sorte, das einen aus der Bahn werfen kann: Mir würde, so wurde mir gesagt, eine „großartige politische Laufbahn“ bevorstehen. Nicht wegen meiner politischen Klugheit (von der ich natürlich überzeugt war). Tatsächlich würde ich sogar meistens ziemlich daneben liegen, aber (und das war als Lob gemeint) aufgrund meiner „rhetorischen Fähigkeiten“ würde das niemand merken. Ich müsse jetzt nur noch lernen, mich an die Parteilinie zu halten, dann wäre alles möglich.
Noch am selben Abend entschied ich mich, auf eine politische Karriere zu verzichten. Denn ich war jung, talentiert und vor allem: arrogant.
Dass ich mich die meiste Zeit irren sollte, war absurd. Ich hatte recht. Immer. Und deshalb hätte im Zweifel die Partei meiner Linie folgen müssen und nicht umgekehrt. Diese Entscheidung habe ich tatsächlich nie bereut. Auch wenn ich sie aus den völlig falschen Motiven heraus getroffen habe. Tatsächlich habe ich erst sehr viel später gelernt, dass nicht nur meine Partei oft daneben lag. Sondern auch ich.
Vor allem aber: Dass die Frage des Umgangs mit Irrtümern, den eigenen und den fremden, von ganz entscheidender Bedeutung für Demokratien und für Demokrat*innen ist.
Viele von uns verstehen Demokratie als eine Art Spielregel. Eine Spielregel, die das Ringen darum organsiert, Irrtümer zu vermeiden und das Richtige zu tun. Doch tatsächlich ist Demokratie weit weniger Regel als Haltung. Die spezifischen Regeln sind in jeder Demokratie anders, oft grundlegend verschieden. Die Haltung, die sie braucht, um zu funktionieren, ist jedoch immer dieselbe. Diese Haltung wird gerne übersehen. Weil sie schwer greifbar ist. Und weil die Regeln im alltäglichen Ringen bedeutender erscheinen.
Zur demokratischen Haltung gehört es, natürlich, Mehrheiten zu akzeptieren. Aber nicht absolut. Das Ringen um die Veränderung von Mehrheiten ist nicht nur legitim. Es ist wesentliches Motiv für Wahlkämpfe, Parteiprogramme, Debatten und Beteiligung.
Denn genauso zur demokratischen Haltung gehört das Wissen, dass die Mehrheit nicht unbedingt immer richtig liegt. Demokratische Wahlen und Abstimmungen garantieren keineswegs, dass das Ergebnis „richtig“ sein muss, dass es das „bestmögliche“ sein muss, ja nicht einmal, dass „am breitesten akzeptierte“. Es ist oft so. Aber nicht immer.
Natürlich hat umgekehrt die Minderheit nicht automatisch recht. Aber zu einer demokratischen Haltung gehört die Bereitschaft, dies zumindest für möglich zu halten.
Das ist keine Großzügigkeit gegenüber demokratischen Verlierer*innen, sondern elementar für die Resilienz einer Demokratie. Denn die muss sich permanent weiterentwickeln, sonst überlebt sie sich.
Noch vor nicht allzu langer Zeit waren Ideen wie ein Verbot der Prügelstrafe, die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Beziehungen, breite Bildungsangebote auch für Kinder ohne wohlhabende Eltern zunächst nur Minderheitsmeinungen, weit entfernt von gesellschaftlicher Mehrheitsfähigkeit. Bis sich das änderte.
Genau das ist die Stärke einer funktionierenden Demokratie: die Möglichkeit zu Fortschritt und Veränderung. Dazu brauchen wir aber genau jene, die heute noch in der Minderheit sind, die Parteilinien und Fraktionszwänge nicht ignorieren, aber hinterfragen. Die sich im Recht wähnen und die Mehrheit im Unrecht. Zwar ist die Chance groß, dass dem nicht so ist. Aber genau dafür muss es Diskurse und Debatten geben.
Der Kommunist und Dichter Bertold Brecht hat uns einen Text beschert, der nachdenklich macht. Ausgerechnet in seinem Gedicht „Lob der Partei“ heißt es, gerichtet an einen Genossen, der die Partei verlassen will:
„Trenne dich nicht von uns! Wir können irren, und du kannst recht haben, also trenne dich nicht von uns!“
Wie wir heute wissen, neigte die Partei Bertolt Brechts nicht dazu, diesen Satz zu beherzigen. Der Untergang der DDR hat zu großen Teilen auch etwas damit zu tun, dass genaue jene Reformbereitschaft im System nicht vorhanden war. In einem demokratischen System gibt es sie. Aber oft nur in der Theorie. In der Praxis neigen auch wir dazu, abweichende Meinungen als lästig zu empfinden, weil sie im System zunächst einmal eines tun: Sie stören.
Und das ist schade. Denn es sind genau diese Störungen, die auf lange Sicht unsere Demokratie stark machen. Ein kindliches Immunsystem kann sich nicht herausbilden, wenn das Kind im keimfreien Raum aufwächst. Gleiches gilt auch für unser demokratisches Immunsystem. Vor diesem Hintergrund empfehle ich bei der Planung von demokratischen Prozessen – ob in Parteien, als Bürgerbeteiligung oder anderen Formaten der Meinungsbildung – zumindest einmal von folgender Hypothese auszugehen:
Was wäre, wenn die Anderen, die Störenden, die Minderheit, die Lästigen recht hätten und wir unrecht? Wäre unser Prozess in der Lage, dann das richtige Ergebnis zu produzieren?
Er sollte es sein. Wenn nicht, ist das Problem nicht die Minderheit, sondern der Prozess.
Dieser Perspektivwechsel ist übrigens immer gut und wichtig. Selbst dann, wenn – was meistens der Fall ist – die Mehrheit doch recht hat. Warum?
Weil er uns hilft, den Prozess aus dem Blickwinkel jener zu sehen, die sich im Recht fühlen, aber in der Minderheit sind. Nur dann können wir ihn so gestalten, dass diese Akteure sich nicht von Anfang an überfahren und majorisiert fühlen. Das fällt schwer.
Besonders dann, wenn die Minderheitsmeinung für uns offensichtlicher Blödsinn ist. Doch das ändert nichts an der Wahrnehmung des Prozesses durch eben jene Minderheit. In einem solchen Fall sehen wir es schlicht als Training.
Wer Menschen einen wertschätzenden Umgang anbietet, deren Meinung er nicht teilt, stärkt unsere Demokratie. Nicht jene, die sich mit taktischen Tricks oder rhetorischer Kompetenz immer durchsetzen, egal ob sie recht haben oder nicht. Mein eingangs erwähntes jugendliches Ich hat das irgendwann auch gelernt. Allerdings erst sehr viel später. Und auf eine sehr schmerzhafte Art.
Doch das ist eine Geschichte, die ich Ihnen ein anderes Mal erzähle …