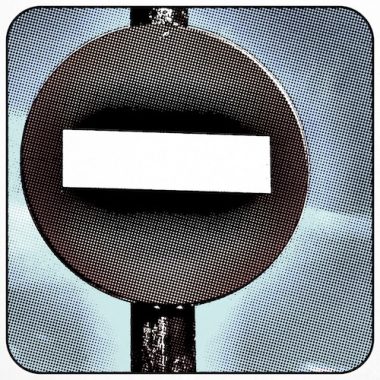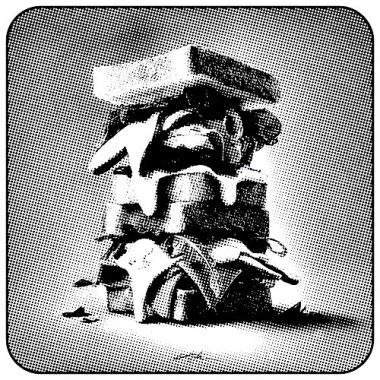Ausgabe #168 | 23. März 2023
Rote Ampeln und weiße Linien
Meine Familie ist ausgesprochen frankophil. Wir haben Freunde in Frankreich. Meine Frau und alle meine vier Kinder sprechen ganz gut Französisch. Sie lieben das Land, die Leute, die Kultur.
Und doch sind wir Deutsche.
Und deutsch sozialisiert. Nichts zeigt das besser als ein Vorfall bei einer unserer Reisen in den Süden Frankreichs.
Es war schon nach Mitternacht. In einem Vorort Montpelliers. Hinten in unserem Van schliefen die Kinder bei offenem Fenster. Selbst um diese Uhrzeit hatte es noch fast 30 Grad.
Weit und breit war kein Mensch und kein Auto zu sehen. Vor uns sprang eine Ampel auf Rot. Wir hielten an. Die Ampelphase dauerte ewig. Gelangweilt trommelte ich mit den Fingern auf dem Lenkrad.
Plötzlich dröhnte direkt hinter uns eine Polizeisirene. Nur für eine halbe Sekunde. Aber alle im Auto waren wach.
Hinter uns stand ein Wagen der örtlichen Gendarmerie. Der Uniformierte hinter dem Steuer fuchtelte wild mit den Händen und rief „Allez! Allez!“.
Zögerlich schlich ich über die Kreuzung. Direkt dahinter zog der Polizist an uns vorbei, winkte noch einmal fröhlich und entschwand in der Dunkelheit.
Später klärten uns französische Freunde auf: Rote Ampeln sind auch in Frankreich rote Ampeln. Und sie zu überfahren, ist in Frankreich sogar noch teurer als in Deutschland. Aber nachts? Wenn Niemand zu sehen ist? „Da halten nur Deutsche“, sagte mein französischer Freund.
Tatsächlich haben wir Deutschen ein spezielles Verhältnis zu Regeln. Wir befolgen sie nicht nur, wir brauchen sie sogar. Und wenn es sie gibt, dann gelten sie auch.
Sätze wie jener auf der Homepage des Fremdenverkehrsamts im französischen Küstenort Serignan gäbe es in Deutschland nicht. Dort steht (übersetzt): „Hunde am Strand sind verboten. Werden aber toleriert.“
Für Deutsche ergibt dieser Satz keinen Sinn. Er macht uns unsicher, hilflos.
Bei uns bricht schon beinahe der Verkehr zusammen, wenn einmal Fahrbahnmarkierungen auf der Straße fehlen. In der kleinen Gemeinde Lohfelden fehlten fünf Jahre lang die Mittelstreifen auf einem kurzen Straßenstück mit einer Kurve: Ergebnis: 36 Unfälle.
In Görlitz sagte kürzlich ein Polizeisprecher zum erhöhten Unfallaufkommen an einer zentralen Kürzung: „Die Ursache liegt in der fehlenden Fahrbahnmarkierung“, die Presse schrieb, man könne „Fahrfehler im Sekundentakt zählen.“
Ob rote Ampeln oder Leitlinien auf den Straßen: In Deutschland brauchen wir Regeln, um zu funktionieren.
Das mag einer der Gründe sein, warum wir Leitlinien nicht nur im Straßenverkehr haben, sondern auch in der demokratischen Teilhabe.
Sogenannte „Leitlinien für Bürgerbeteiligung“ haben bereits zahlreiche Kommunen in Deutschland. In unserem Berlin Institut für Partizipation haben wir knapp 200 davon erfasst und analysiert.
Sie sind sehr unterschiedlich, es gibt kurze wie in Potsdam, die auf einer Seite Platz finden. Es gibt komplexe Regelwerke wie in Heidelberg, die auf 64 Seiten den Rahmen für Beteiligung vorgeben. Seit 2019 hat sogar das Bundesumweltministerium eigene „Leitlinien Gute Bürgerbeteiligung“.
Ebenso unterschiedlich wie die Leitlinien selbst ist auch ihre Entstehungsgeschichte. Heidelberg war nicht nur ein Frühstarter, dort begann der Prozess schon 2011. Vor allem aber wurde er intensiv unter Beteiligung von Bürger*innen realisiert.
In Potsdam ließ man die Beteiligung erst von externen Expert*innen konzipieren, scheiterte damit im Gemeinderat und entwickelte dann in einem partizipativen Prozess das heutige Konzept.
Das Umweltministerium wiederum ließ sich seine Leitlinien im Wesentlichen von zwei externen Dienstleistern erarbeiten, die nun sogar in den gedruckten Fassungen als „Herausgeber“ fungieren.
Welche Leitlinien sind nun aber die besten? Welche taugen nix?
Tatsächlich erleben wir bei unseren Evaluationen immer wieder, dass einzelne Vorgaben von beschlossenen Leitlinien entweder in der Praxis gar nicht umgesetzt werden – oder sich als problematisch erweisen.
Das ist auch gut so. Es ist ja in der Regel genau die Aufgabe einer Evaluation, zu ermitteln, wo etwas verbessert werden könnte.
Dabei ergibt sich jedoch ein nicht überraschendes, aber gleichwohl wichtiges Bild:
Die höchste Relevanz für die Praxis haben Leitlinien tendenziell dann, wenn sie nicht extern (Dienstleister) oder rein intern (Verwaltung) erarbeitet wurden. Die stärksten Leitlinien sind jene, die Ergebnis eines partizipativen Prozesses sind.
Die Idee, Leitlinien für Partizipation partizipativ zu entwickeln, liegt eigentlich nahe, ist aber längst nicht Standard. Und das gilt nicht nur für Ministerien. In der Leitliniensammlung unseres Instituts finden sich seitenweise 1:1 Kopien.
Nun ist es kein Verbrechen, die Leitlinien einer anderen Kommune abzuschreiben. Besonders klug ist es aber auch nicht. Denn dahinter steckt die typisch deutsche Idee, dass gute Leitlinien automatisch für gute Beteiligung sorgen.
Die beste Garantie für gute Beteiligung ist eine positive Beteiligungskultur. Und die muss in der Praxis entstehen – zum Beispiel im Rahmen eines partizipativen Leitlinienprozesses.
Warum?
Weil selbst mit den besten Leitlinien immer wieder Herausforderungen entstehen können. Weil Leitlinien auch „altern“ können. Weil manchmal die Praxis den Leitlinien enteilt, und das durchaus auch in positivem Sinne.
Leitlinien sind keine roten Ampeln. Und wenn, dann eher die französische Version.
Und auch, wenn es uns Deutschen manchmal etwas schwerfällt: Das wirklich Wichtige an Leitlinien sind nicht Umfang oder Detailtiefe.
Sondern der Entstehungsprozess.
Partizipativ entstandene Leitlinien haben – bereits bevor sie beschlossen werden – oft schon mehr bewirkt als Plagiate. Sie sind ein Booster für die kommunale Beteiligungskultur. Und wenn sie einmal nicht perfekt sind?
Auch dann sind sie stärker als ihre nicht partizipativ entwickelten Schwestern.
Kürzlich evaluierte unser Institut die leitlinienbasierten Beteiligungsstrukturen in einer ostdeutschen Landeshauptstadt. Im Ergebnis gab es Reformbedarf. Für Kommunalpolitik und Verwaltung war rasch klar: Der partizipative Prozess, indem die Leitlinien damals entwickelt wurden, wird einfach neu einberufen.
Die gemeinsamen Lernerfahrungen von Bürgerschaft, Verwaltung und Politik können also in die Überarbeitung einfließen.
Und genau so soll es sein.