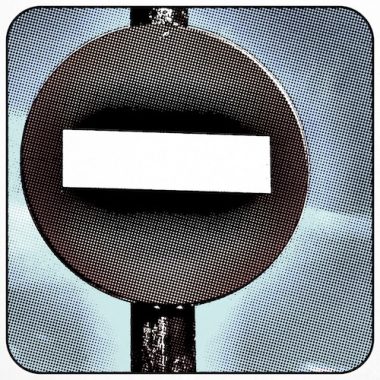Ausgabe #216 | 22. Februar 2024
Stranger Strings
Als Reed Hastings Ende der 90er Jahre beschloss, eine Videothek zu eröffnen, dachte er innovativ.
Er wartete nicht, dass die Kund*innen zu ihm kamen, um VHS-Kassetten auszuleihen. Er kam zu ihnen.
Die Kund*innen bestellten ihre Filme online. Reed und sein Team tüteten dann die damals gerade neu entwickelten DVDs in dicke rote Umschläge und brachten sie zur Post.
Am Anfang funktionierte das gar nicht. Zu wenig Leute hatten einen DVD-Player. Die Postgebühren belasteten die Kunden zusätzlich.
Doch das änderte sich rasch. Reed führte nach kurzer Zeit ein Flatrate-Abo ein. DVD-Player standen bald in jedem Haushalt. Der Umsatz stieg und stieg.
Doch Reed war clever. Er sah frühzeitig die Chancen, die schnelles Internet bot.
Und während Anfang der 2000er Jahre die klassischen Videotheken eine nach der anderen dicht machten, stieg er ins Streaming-Geschäft ein.
Heute kennen wir seine Firma als den wohl bedeutendsten Streaming-Dienst des Planeten: Netflix.
Allein die Top-Serie Stranger Things wurde in manchen Monaten über 1 Milliarde Stunden gestreamt.
Ein Wunder eigentlich. Denn folgt man den ungeschriebenen Gesetzen der Filmindustrie, dann hätte genau diese Serie nie fliegen dürfen.
Sie ist keinem Genre zuzuordnen. Wikipedia nennt sie eine Science-Fiction-Mystery-Serie. Sie hat eine überwältigend große Schar von Protagonist*innen. Und der Plot ist ebenso wirr wie anspruchsvoll.
Weder die Charaktere noch die Zuschauer*innen blicken durch, wer da nun wirklich welche Rolle in der Geschichte spielt. Es gibt zwei Parallelwelten, zwischen denen die Handlung hin und her springt. Doch am Ende stellen wir fest:
Alles hängt irgendwie mit allem zusammen.
Was in der einen Welt passiert, beeinflusst die andere. Was die einen tun, verändert die Möglichkeiten, Ziele und Handlungen der anderen.
Irgendwie ganz genau so wie in vielen Prozessen der demokratischen Teilhabe.
Erstaunlich oft vermitteln Beteiliger und Beteiligte auch dort den Eindruck, keinen Plan zu haben. Einzelereignisse hängen irgendwie zusammen. Was heute noch als sicher gilt, ist morgen manchmal schon Makulatur.
Und besonders dann, wenn Entscheider*innen und Betroffene tatsächlich einmal in den Dialog kommen, haben manche den Eindruck, zwei Parallelwelten prallen aufeinander.
Das muss nicht sein. Und der Fairness halber sei gesagt: Es ist auch oft nicht so.
Nämlich dann, wenn die Kriterien Guter Beteiligung wirklich ernsthaft umgesetzt werden. Wenn einzelne Gruppen gute, wirksame, auf sie zugeschnittene Angebote wahrnehmen können. Wenn Dialog auf Augenhöhe angestrebt wird. Wenn die Interessen und Erwartungen transparent werden. Wenn die Moderation fair, zugewandt und wertschätzend ist.
Dann kann Beteiligung als wunderbarer Prozess konkret erlebter Selbstwirksamkeit funktionieren.
Oder auch nicht.
Denn selbst, wenn die obigen Kriterien zutreffen, kann am Ende noch immer Frust, Kritik oder gar Scheitern drohen.
Warum?
Weil gerade besonders zielgruppenspezifisch und medial innovativ geplante Prozesse einem besonderen Risiko unterliegen:
Sie werden möglicherweise nur von den Beteiligenden als EIN Prozess wahrgenommen.
Die Beteiligten haben ihre Rollen. Oft nur für einen kleinen Teilzeitraum, ein bestimmtes Format, in einem bestimmten Medium.
Die einen posten Ideen in ein Online-Forum. Die anderen diskutieren intensiv in einer Planungszelle oder einem Bürgerrat. Dritte bepunkten ihre Vorlieben Samstag auf dem Markt am mobilen Beteiligungsstand. Im Jugendzentrum basteln Kids mit Pappe ein Zukunftsmodell. Und rüstige Rentner*innen werden zu einem „partizipativen Stadtspaziergang“ eingeladen.
Alle zusammen beteiligen sich so zum Beispiel daran, die eigene Kommune klimaresilienter zu machen.
Kling erstmal super.
Ist es aber nicht zwangsläufig. Denn es beteiligen sich Viele. Das ist gut.
Aber eben nicht „zusammen“. Das ist gefährlich.
Eigene Formate machen Sinn. Aber eben nicht als Streuselkuchen. So weiß am Ende niemand, was er oder sie nun wirklich zum Endergebnis beigetragen hat.
Vor allem ist die größte Chance nicht genutzt worden: Dialoge zwischen Gruppen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Sichtweisen, Kulturen und Interessen zu initiieren.
Was solche multiformale Prozess brauchen, sind Strings – also Vernetzungen. Erst dann wird der EINE Beteiligungsprozess der Beteiligenden auch einer der Beteiligten.
Diese Strings können wir auf sehr unterschiedliche Art herstellen.
Gibt es eine digitale Beteiligungsplattform, können sie tatsächlich sogar bildhaft als Prozessstruktur grafisch dargestellt werden.
Wichtig ist, dass in jedem String erläutert wird, welche Ergebnisse wie in das verbundene Format einfließen – und zurückgekoppelt werden.
Diese Verknüpfung kann durch schriftliche Berichte (Mit Kernergebnissen) geschehen. Oder durch Personen aus den einzelnen Formaten, die gegenseitig berichten. Möglicherweise bei größeren Vorhaben auch durch einen projektbezogenen Beirat mit Menschen aus den unterschiedlichen Gruppen.
Auftakt- und/oder Abschlussformate, zu denen alle Gruppen eingeladen werden, können das alles umrahmen und konsolidieren.
Selbst bei kleineren Prozessen, mit nur zwei oder drei zielgruppenspezifischen Formaten geht das – und ist entsprechend weniger aufwändig.
Welchen Ansatz auch immer man wählt, wichtig ist: Je diverser die Formate, desto wichtiger sind Strings.
Welche davon gebraucht werden, erzählt sich oft von alleine. Wenn beim Prozessdesign einmal bewusst die Perspektive jeder beteiligten Gruppe eingenommen und gefragt wird: Was braucht es, damit es auch für sie EIN Prozess wird, in dem sie sich nicht nur finden, sondern auch als wirksam wahrnehmen können?
Auf diesem Weg kommen wir zu dem, was letztlich diverse Prozesse erst richtig stark macht:
Stranger Strings.