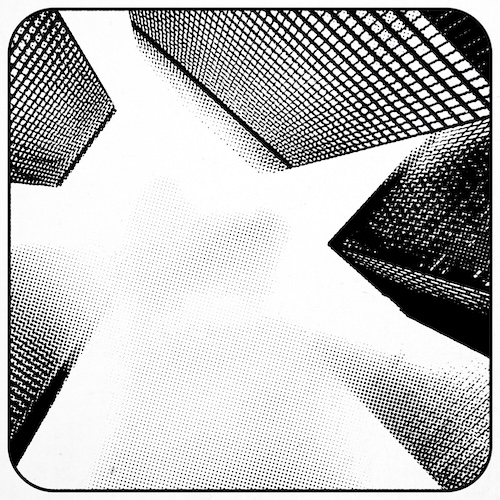Ausgabe #220 | 21. März 2024
Die Firma
Tom Cruise war schon ein internationaler Top-Star, als er die Hauptrolle in dem Film „Die Firma“ übernahm.
Der Film war solide. Doch Cruise lieferte unmittelbar davor und danach Blockbuster wie Eine Frage der Ehre, Interview mit einem Vampir oder Mission Impossible ab.
Deshalb ging die Firma ein wenig unter. Das ist schade. Der Film ist nicht nur spannend, sondern auch ein fantastisches Sittengemälde.
Er spielt nahezu ausschließlich in einer großen Anwaltskanzlei. Cruise in der Rolle des jungen Harvard-Absolventen Mitch McDeere wird von der Kanzlei Bendini, Lambert & Locke angeheuert
Die nehmen jedes Jahr nur die besten Harvard-Absolventen.
Und formen sie nach ihrem Plan. Was zunächst als vermeintlich freundliches Willkommen für Mitch und seine Frau aussieht, entpuppt sich immer mehr als gnadenloses Gleichschaltungsprogramm.
Ob gemeinsamer Sport, Mitgliedschaft im selben Country-Club und selbst private Feiern. Alles geschieht im engen Milieu der Kanzleimitarbeiter*innen und ihrer Familien. Alle reden gleich, sind gleich angezogen, denken gleich.
Als ihn eines Tages das FBI kontaktiert und ihm offenbart, dass er für eine Mafiakanzlei arbeitet, nimmt die Handlung Fahrt auf. Doch wir wollen hier nicht spoilern. Anschauen lohnt sich.
Was sich auch lohnt: darüber zu sprechen, warum Unternehmen immer wieder Teams zusammenstellen, die so homogen wie irgend möglich sind.
„Homogene Teams zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Mitglieder aufgrund einer Vertrauensbasis ausgewählt wurden und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt werden kann. Man kennt sich. Eine Sitzung wird wenig an Überraschungen bringen, weil die Tagesordnungspunkte routinemäßig abgearbeitet werden können“, schreibt die BWL-Professorin Astrid Szebel-Habig.
Das ist eines der Motive. Ein weiteres: Dort, wo Mittelmanager*innen Personalentscheidungen treffen, neigen sie dazu, Menschen einzustellen, die ihnen ähneln. Optisch, biografisch und in ihrem Wertegerüst.
Dort, wo diese Grundähnlichkeit vorhanden ist, neigen frisch ins Team gekommene in besonderem Maße dazu, sich dann noch weiter anzupassen.
Sie lernen Golf, auch wenn sie zuvor Bälle eher getreten denn geschlagen haben. Selbst nach Feierabend in der Kneipe mutieren Bier- zu Weintrinkern. Das ist selten eine bewusste Entscheidung, zunächst oft eher Assimilationsdruck.
Aber es ist förderlich für die Karriere. Irgendwann wird aus dem Teammitglied ein Teamleiter – und die Linie setzt sich fort.
Homogene Teams sind gut fürs Betriebsklima. Sie haben allerdings oft verheerende Folgen.
Der Innovationsforscher Prof. Dr. Sascha Friesike entdeckte, dass homogene Teams niedrige Diskussionskosten, aber auch ein geringes Innovationspotenzial haben.
Vor allem aber produzieren sie weniger Konflikte. Und das ist ein Problem.
Denn so können nicht nur kriminelle Strukturen wie in der Firma gedeckt werden, auch Korruption, Übergriffigkeit und andere Dinge bleiben in konfliktarmen Strukturen länger unerkannt.
Fehlerkultur, Innovation, kreative Produkte und Strategien, rasche Reaktion auf veränderte Umgebungsbedingungen – all das gelingt besser, wenn Teams weniger homogen sind.
In der Betriebswirtschaft ist längst anerkannt, dass diverse Teams bessere Teams sind.
In diversen oder heterogenen Teams weisen die Mitglieder eine Vielzahl von Unterschieden und Vielfalt auf, insbesondere in Bezug auf ihre Hintergründe, Erfahrungen, Fähigkeiten, Perspektiven, Werte, Geschlechter, ethnischen Zugehörigkeiten oder Kulturen.
Sie sind innovativer und erfolgreicher. Sie sind aber auch konfliktträchtiger.
Ganz ähnlich ist es in Prozessen der demokratischen Teilhabe.
Wir wissen, welche Milieus sich tendenziell eher und öfter beteiligen. Und je mehr diese Milieus in Beteiligungsprozessen unter sich sind, desto größer ist die Chance auf wenige, leichter zu bewältigende Konflikte.
Und es ist gar nicht so schwer, dafür zu sorgen: Ein Beteiligungsangebot schlicht öffentlich auszuschreiben, am besten in einem Printmedium wie Tageszeitung oder Gemeindeblatt, wirkt wie ein verlässlicher Filter:
Es kommen tendenziell eher Ältere, Menschen mit höherer formaler Bildung, überdurchschnittlichem Einkommen, guten Deutschkenntnissen – und oft auch überwiegend Männer.
Migrant*innen, junge Erwachsene, Menschen mit niedrigem Bildungsgrad und/oder Einkommen werden so kaum angesprochen.
Das ist der Grund, weshalb wir über „Breite Beteiligung“ sprechen. Breit meint eben genau diese Diversität im Kreis der Beteiligten herzustellen. Das gelingt über unterschiedliche Hebel.
Eine Idee ist das gewichtete Losverfahren, das wir aus Bürgerräten kennen.
Doch weil auch hier Geloste aus den beteiligungsfernen Gruppen tendenziell viel seltener zusagen, bleibt am Ende nur das Aufsuchen. An vielen Türen zu klingeln, sich viele Absagen anzuhören, ist nicht leicht. Aber oft die einzige verlässliche Möglichkeit. Und eine bewährte.
Aber auch eine, die immer wieder von zwei Missverständnissen geprägt ist.
Zum einen geht es bei dieser Form der Teilnehmerakquise nicht primär darum, später behaupten zu können, man habe „breit“, also „gut“ beteiligt.
Im Fokus liegt die Breite im Teilnehmerpanel deshalb, weil sie zu Inhomogenität führt. Und damit zu Konflikten, die es braucht, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Wer breiter beteiligt, muss mit mehr Konflikten rechnen. Und das ist nicht schlecht.
Das ist das Ziel.
Darüber muss sich im Klaren sein, wer über breite Beteiligung nachdenkt. Konfliktfrei zu beteiligen, geht in homogenen Gruppen besser. Macht aber im Grunde wenig Sinn.
Denn wo es keine Konflikte gibt, braucht es keine Beteiligung.
Das zweite Missverständnis beobachten wir noch häufiger. Es ist weniger bedeutend, aber dennoch nicht ohne Tücken:
Aufsuchende Teilnehmerrekrutierung ist gut, oft alternativlos, wenn eine gewisse Breite in der Beteiligung angestrebt wird.
Aber eines ist sie nicht: Aufsuchende Beteiligung.
Das ist etwas anderes. Und das schauen wir uns in der kommenden Woche an.