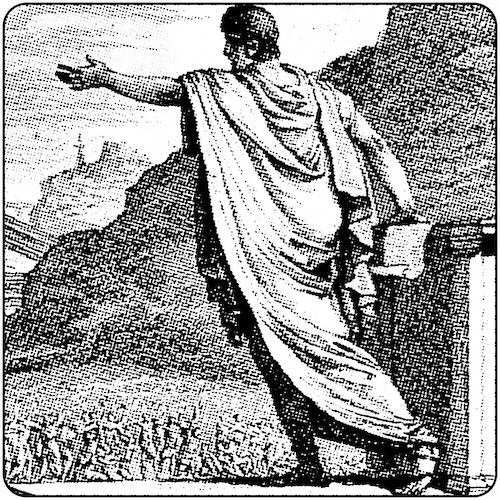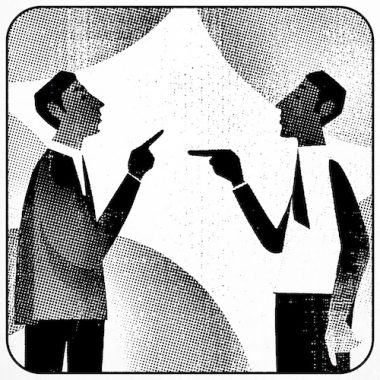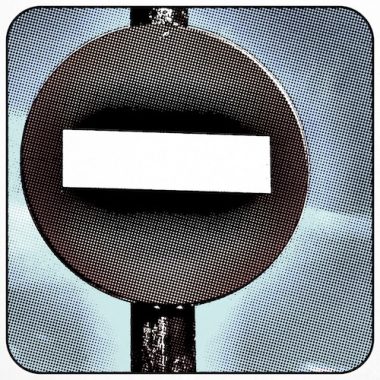Ausgabe #230 | 30. Mai 2024
Der Volkstribun
Aktuell erleben wir immer wieder körperliche Übergriffe auf Menschen, die sich politisch engagieren.
In manchen Parteien gibt es bereits die Vorgabe, Plakate nur noch tagsüber und in Gruppen von mindestens vier Personen aufzuhängen – um bei Attacken wehrhaft zu sein.
Das rüttelt an den Grundpfeilern unserer Demokratie: dem politischen Engagement für demokratische Ziele, Werte und Parteien.
Dabei ist dies kein ganz neues Thema. Schon vor über 2.000 Jahren gab es im alten Rom Regeln, die Übergriffe auf politisch Aktive verhindern sollten.
Tatsächlich konnte schon der bloße Versuch, einen römischen Politiker körperlich anzugreifen, mit dem sofortigen Tod geahndet werden.
Das galt insbesondere für eine bestimmte Funktion, die wir heute so nicht (mehr) kennen.
Denn die alten Römer hatten ein sehr feines Gespür für Macht.
Dafür, wie man sie gewinnt, wie man sie ausübt, aber auch: Wie man sie kontrolliert.
Schon in den Anfängen der römischen Republik, also rund ein halbes Jahrtausend vor Christus, entstand deshalb die Rolle der Volkstribune.
Lange hatte ihre Rolle wenig mit dem zu tun, was wir in späteren Zeiten und heute aus diversen Historienfilmen über sie denken: karrieregeile Intriganten, die dem Volk nach dem Maul redeten und als Vorläufer unserer modernen Populist*innen gelten.
Die ursprüngliche Aufgabe der Volkstribune war eher eine Mischung aus Betriebsrat und Klassensprecher. Sie waren keine öffentlichen Beamten, sondern informelle Vertreter der Plebejer gegen die Macht der Patrizier.
Bei Bedarf gegen Entscheidungen und Maßnahmen patrizischer Beamter und des Senats vorzugehen, das war ihre Rolle.
Und sie waren heilig. Ihre Person galt als sakrosankt. Wer auch nur versuchte, einen Volkstribun körperlich anzugreifen, durfte sofort vom Volk getötet werden.
Ein Volkstribun bewegte sich daher demonstrativ unbewaffnet.
Umgekehrt mussten Volkstribune für die einfachen Menschen jederzeit ansprechbar sein. Daher war es ihnen nicht erlaubt, ihre Haustüre nachts abzuschließen. Auch durften sie Rom für keinen ganzen Tag verlassen, egal aus welchem Grund.
Rolle, Zahl und formelle Rechte der Volkstribune veränderten sich im Laufe der Jahrhunderte.
Die Grundidee blieb aber lange Zeit dieselbe:
Eine Instanz, die die Rechte der relativ Machtlosen wahrte, die stellvertretend für jene einschritt, die eine Intervention benötigten, ohne selbst die Macht, oder den Mut dazu zu haben.
Tatsächlich ist eine solche Option von herausragender Bedeutung für die Stabilität und Akzeptanz eines politischen Systems. Sogar unser modernes Petitionsrecht hat hier eine seiner Wurzeln.
Auch die zunehmende Bedeutung von Compliance- oder Diversity-Beauftragten in modernen Unternehmen dockt hier an.
Gerade, wenn in Institutionen oder Prozessen ein starkes Machtgefälle herrscht, sind solche Strukturen besonders relevant.
Das gilt, auch wenn es auf den ersten Blick überrascht, ebenfalls für moderne Beteiligungsprozesse.
Warum? Ist ihre Aufgabe doch eigentlich, Demokratie zu stärken, Macht auszugleichen, auf Dialog zu setzen.
Tatsächlich lohnt es sich, mit dem römischen Gespür für Macht einmal genauer auf Beteiligungsverfahren zu schauen.
Die sind nämlich alles andere als machtfrei. Es fängt damit an, dass Thema, Prozess, Ressourcen, Prozessleitung und -moderation in aller Regel vorher einseitig festgelegt werden.
Strukturell werden nach wie vor die meisten Rahmenbedingungen ohne jene entschieden, die diesen Prozess inhaltlich ausfüllen sollen. Oft geht das auch nicht anders. Manchmal schon.
Hinzu kommt, dass gerade in dialogischen Prozessen der Meinungsbildung jene erheblich bevorteilt sind, die intellektuell und rhetorisch besonders qualifiziert und/oder besonders selbstbewusst sind.
Eine gute Moderation kann da vieles nivellieren. Aber auch hier gilt: Prozessuale Macht rangelt mit sozialer Macht.
Für jene, die über keines von beiden verfügen, bleibt oft nur die Zuschauerrolle.
In der Praxis führt dies dazu, dass es meist dieselben Milieus sind, die sich zunächst innerlich, dann oft auch körperlich aus solchen Prozessen verabschieden:
die sprachlich weniger Beschlagenen, die Stilleren, jene mit weniger selbstwirksamkeitsgestähltem Selbstbewusstsein – genau jene, die oft schon nur mühsam in solche Prozesse reinzuholen sind.
Nun brauchen Beteiligungsprozesse nicht unbedingt Klassensprecher*innen oder Volkstribune. Was die stillen Beteiligten aber gut brauchen können: eine Chance, zu agieren, zu intervenieren, auch zu protestieren.
Diese anzubieten, ist gar nicht so aufwändig. Es geht in nahezu allen Formaten. Im Prozessdesign braucht es dazu nur eine kompakte Frage: „Wie stellen wir sicher, dass auch stille Beteiligte Impulse einbringen können?“
Das ist der Grund, warum zum Beispiel in Videokonferenzen, auf die ich selbst einen Einfluss habe, der Chat immer für alle offen und anonym bespielbar ist. Gerade bei kritischen Themen wird das gern vermieden.
Genau dann sollte man dieses Ventil aber anbieten – und jemanden haben, der es in Echtzeit scannt und der Moderation Hinweise gibt, wenn dort wichtige inhaltliche oder prozessuale Impulse entstehen.
Bei längeren Prozessen können (anonyme) Feedbackbögen zwischen den einzelnen Events oder Phasen eine solche Reflexion ermöglichen.
Bei Präsenzdiskussionen – gerade wenn es viele Menschen mit diversen Hintergründen sind – nutze ich oft bewusst digitale Feedback-Tools wie Slido, Mentimeter oder zur Not einfach ein Google-Dokument.
Dort können (auf Wunsch anonym) Fragen gestellt, Feedback gegeben, kritische Kommentare eingespeist werden. Genau von jenen, die nicht zu Wort kommen können – oder wollen.
Dieses Konzept der „anonymen Intervention“ stellt höhere Anforderungen an die Organisation und Moderation. Macht aber Prozesse besser, Ergebnisse wertvoller und mehr Beteiligte wirksamer.
Neben dieser anonymen Intervention gibt es noch ein ergänzendes, ggf. auch alternatives Tool: die parallele Reflexion. Die schauen wir uns ein anderes Mal an.
Für heute schließen wir mit der Feststellung: Auch Beteiligung ist nie machtfrei.
Prozessdesign muss das berücksichtigen.
Und möglichst allen Beteiligten möglichst gleiche Chancen zur Wirksamkeit geben.
„Das Gleiche“ muss, und das ist die wesentliche Botschaft für Gute Beteiligungsprozesse, dabei nicht immer „dasselbe“ sein.