Ausgabe #232 | 13. Juni 2024
Paartizipation
Schon 2017 erschienen ist eine Studie des Umweltbundesamtes. In ihr ging es darum, wie Beteiligung inklusiver werden kann.
Leider hat die Studie in der Praxis relativ wenig Beachtung gefunden. Was auch am komplex formulierten Titel liegen kann:
„Impulse zur Bürgerbeteiligung vor allem unter Inklusionsaspekten – empirische Befragungen, dialogische Auswertungen, Synthese praxistauglicher Empfehlungen zu Beteiligungsprozessen“
Das klingt in der Tat etwas sperrig.
An der zu geringen Anzahl von Autor*innen kann es eher nicht gelegen haben. Gleich fünf werden als Urheber*innen genannt. Das ist für Studien eine zwar eher große, aber nicht ganz untypische Zahl.
Die Gründe für so lange Autorenzeilen sind in der Wissenschaft vielfältig.
Ein Effekt ist aber interessant und sogar messbar: Wissenschaftliche Veröffentlichungen von mehr als drei Autor*innen werden nachweislich öfter zitiert als solche von kleineren Gruppen.
Das sollte jene Menschen, die sich mit Partizipation beschäftigen, eigentlich freuen. Korrespondiert es doch mit der „Weisheit der Vielen“, die in Beteiligungsprozessen immer wieder gerne zitiert wird.
Da ist auch etwas dran.
Doch es ist anspruchsvoll, das Wissen, die Erfahrung und die Kreativität möglichst vieler in einen Prozess einfließen zu lassen.
Tatsächlich gibt es eine Erkenntnis, die zu diesem Ansatz in direktem Widerspruch steht:
Die Bioinformatiker Prof. Dr. Martin Lercher von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und Prof. Dr. Itai Yanai von der New York University forschen zu Kreativitätsprozessen.
Und sie haben festgestellt, dass größere Gruppen eher dazu neigen, bestehende Konzepte weiterzuführen.
Das größte Kreativitätspotential sehen sie in Zweiergruppen.
Paare produzieren am besten kreative Ideen. „It takes two to think“, lautet eine vor kurzem erschienene Publikation der beiden Forscher.
Auf die Zahl der Gesprächspartner*innen kommt es an. Die Dynamik großer Gruppen, so Lercher und Yanai, stört eher den kreativen Prozess: Hier herrschen andere Gesetze.
Die stärksten, aber nicht unbedingt die klügsten Stimmen dominieren große Brainstormings. Und: Die Gruppenmitglieder ordnen sich oft einem Gruppenkonsens unter und stellen ihre eigenen Gedanken hintan.
Ihre Grundthese lautet: Wir denken kreativer, wenn wir sprechen. „Reden Sie mit anderen. Indem wir sprechen, sammeln wir nicht nur Informationen oder Ideen, sondern wir können auch neue Gedanken improvisieren, die uns allein nicht zugänglich sind.“ Schreiben die beiden unter anderem in ihrem Text.
Ist die „Weisheit der Vielen“ also nur eine Illusion? Keineswegs.
Lercher und Yanai schreiben über Kreativität – nicht über Deliberation.
Es bleibt gerade in Beteiligungsprozessen nach wie vor eine essentielle Aufgabe, möglichst alle bzw. viele Sichtweisen und Ansprüche zu integrieren.
Sie müssen in den Dialog einfließen, wenn es um Interessenausgleich, um Folgenabschätzung, um Widerstände, Akzeptanz oder Toleranz geht.
Doch in fast jedem Beteiligungsprozess braucht es irgendwann auch mal Kreativität, wenn Lösungen gefunden werden sollen.
Und da greifen die Erkenntnisse der beiden Wissenschaftler.
Viele greifen für kreative Phasen gerade auch in Beteiligungsprozessen gerne auf Kleingruppen zurück. Das ist gut.
Besonders gut sind aber eben Paare.
Im Zwiegespräch kommen Beteiligte erheblich öfter und intensiver ins Sprechen als in jedem anderen Format.
Sie lehnen sich deutlich weniger gedanklich zurück. Sie steigen tief ein in die gemeinsame Lösungssuche.
Sie platzieren ihre Perspektiven und erdenken sich neue.
Zwiegespräche sind bislang erstaunlich selten im Design von Beteiligungsprozessen vorgesehen. Auch weil sie sich mangels moderativer Begleitung der Kontrolle entziehen.
Das ist schade, denn sie können über die Deliberation hinaus sogar zusätzlichen Nutzen stiften, wenn sie zum Beispiel in Form von „Gehsprächen“ echte Bewegung ins Spiel bringen.
Das alles sorgt dafür, dass der befürchtete Kontrollverlust durch die positiven Effekte mehr als aufgewogen wird.
Zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, kann dieses erstaunlich einfache Format (mit ein paar basalen Regeln) ein echter Partizipationsbooster sein.
Eine solche Regel empfehlen Lercher und Yanai übrigens ausdrücklich, sie kommt aus dem Improvisationstheater. Anstatt die Ideen des anderen kritisch zu reflektieren, sollen diese besser weitergeführt werden. Sätze sollten also möglichst nicht mit „Nein, aber …“ beginnen, sondern mit „Ja, und …“.
So wie in diesem Fall:
Die „Weisheit der Vielen“ bleibt das stärkste Argument für Beteiligung.
Ja, und um diese vielen in vielfältigen Formaten in Wirkung miteinander zu bringen, braucht es klug eingesetzte Methoden.
Die Paartizipation ist eine davon.
Eine besondere.
Und eine besonders wirksame.
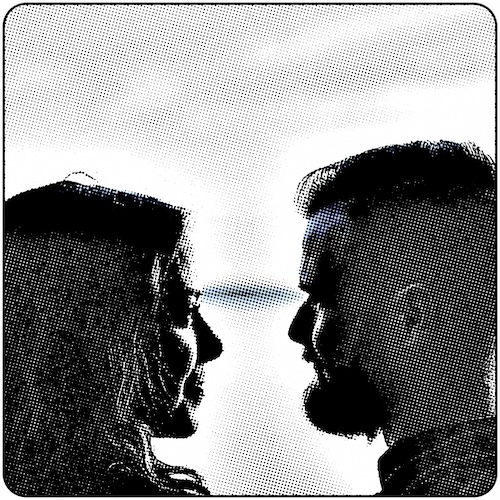

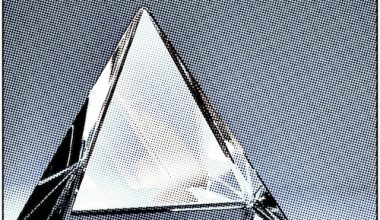



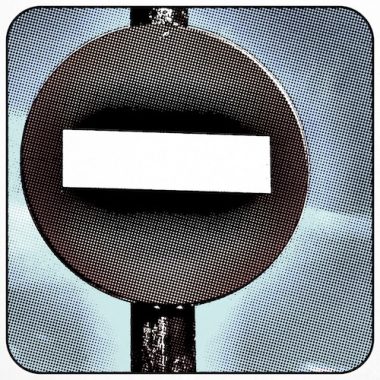
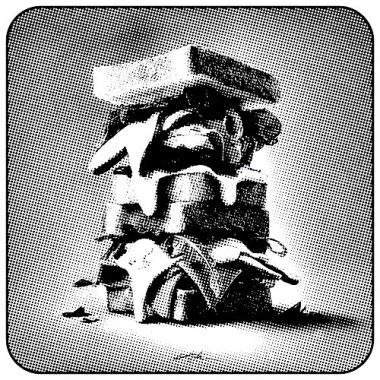
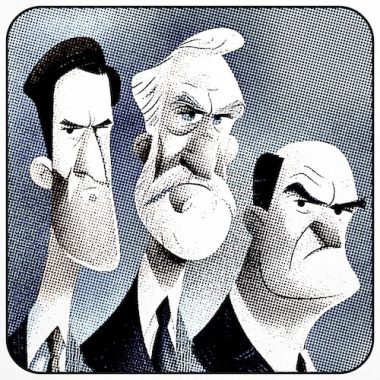
Wir machen in unseren sogenannten Wahlkreistagen (ausgeloste treffen auf Budnestagsabgeordente ihres Wahlkreises) mittlerweile grundsätzlich eine „paar“-session. Dabei bekommen die Paare die Aufgabe sich zum Thema des Tages gegenseitig zu interviewen und zunächst vor allem aktiv zuzuhören (Stichwort Regeln) ehe sie dann in die Diskussion gehen. Erst nach diesen Zweiergesprächen geht es dann in die „größere“ Kleingruppe. Wir haben damit extrem gute Erfahrungen gemacht.
Spannend. Die Zweier-Konstellation ist sicher nicht nur im wissenschaftlichen Kontext hilfreich. Das zeigt jede berufliche Projekt-Runde. Für die Partizipation besteht die Herausforderung vermutlich darin, Ergebnisse aus 2er-Runden nachzuhalten und wieder zusammen zu bringen in die Gesamtgruppe (selbst wenn es nur Fokusgruppen oder anders ausgewählte handelt). Insofern steckt die Arbeit in Ihrem letzten Absatz. Es braucht die richtigen Methoden.
VG.
Herzlichen Dank für die interessanten Informationen, ich kann es bestätigen, die beiden Personen müssen auch beide sehr offen und wertschaetzend kommunizieren.