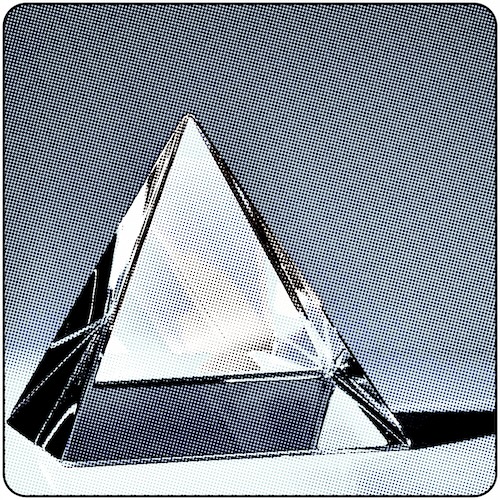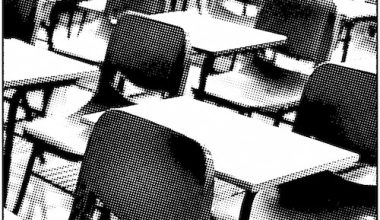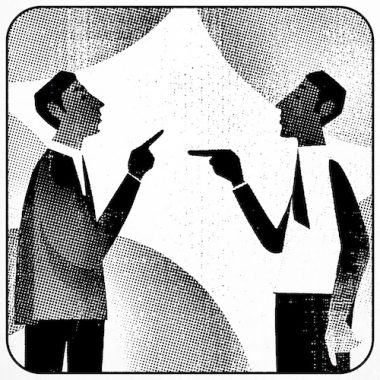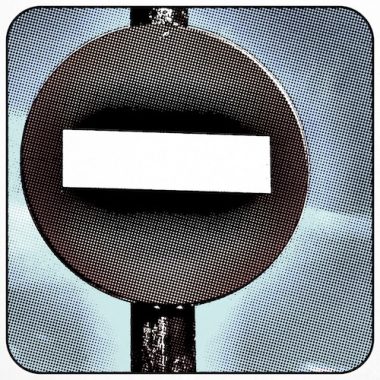Ausgabe #233 | 20. Juni 2024
Pyramidale Partizipation
Der kleine Charles war ein quirliges Kind. Und ein kluges.
Zwar hatte er dank seiner Mutter adelige Wurzeln. Nur leider nicht das entsprechende Vermögen. Tatsächlich wuchs er als Sohn eines italienischen Postbeamten in sehr ärmlichen Verhältnissen auf.
Kein Wunder, dass er so früh wie möglich von Italien in die USA emigrierte. 1903 betrat er amerikanischen Boden. Mit zweieinhalb Dollar in der Tasche.
Er jobbte als Hilfskraft in Restaurants, schlief dort auf dem Boden. Rasch lernte er Englisch. Er arbeitete sich bis zum Kellner hoch. Dann wurde er entlassen, weil er Geld unterschlagen hatte.
In seinem nächsten Job als Bankangestellter lernte er weiter. Der Bankchef bot Kund*innen einen doppelt so hohen Zinssatz wie die Konkurrenz. Finanziert wurde das durch die Plünderung anderer Konten.
Irgendwann brach das System zusammen, sein Boss setzte sich ab. Charles versuchte, in seinem Namen Schecks auf sich auszustellen. Er flog auf und landete im Gefängnis.
Es folgte eine weitere Haftstrafe wegen Menschenschmuggels. Doch irgendwann hatte er genug kriminelle Erfahrung, um endlich erfolgreich zu sein.
Er baute ein System auf, das erstaunlich clever war: In Europa kaufte er sogenannte „Internationale Antwortscheine“. Der Zweck eines Internationalen Antwortscheins war, dem Empfänger eines Briefes die Gebühren für eine Antwort zu erstatten.
Aufgrund des dramatischen Preisverfalls der europäischen Währungen im Verhältnis zum Dollar, konnte man zur damaligen Zeit einen Antwortschein in Europa kaufen und in den USA mit über 500 % Gewinn verkaufen.
Das Problem: Aufgrund der damals langen Postlaufzeiten lohnte sich das Geschäft nicht wirklich.
Charles verdiente damit also nicht viel. Aber er benutzte das Konzept für eine andere Masche: Er warb Kund*innen an, die in sein Geschäft investierten.
Er versprach abenteuerliche Renditen: 50 % Wertzuwachs in 45 Tagen oder gar die Verdoppelung des angelegten Geldes in 90 Tagen.
Das Geschäft lief blendend. Sobald jemand seinen Gewinn sehen wollte, zahlte er ihn aus. Aus den Einlagen der anderen Kund*innen.
Deshalb forderten die vertrauensseligen Anleger*innen ihre Einkünfte nicht ein und ließen ihre „Gewinne“ wieder reinvestieren.
Viele Menschen verpfändeten ihr Haus und ihre Habseligkeiten, um reich zu werden.
Charles wurde in kurzer Zeit extrem reich. Doch bei einer Prüfung des Finanzamts flog er schließlich auf.
Charles landete erneut im Gefängnis, über 40.000 Menschen verloren teilweise alles, was sie hatten.
Die Methode kommt Ihnen möglicherweise bekannt vor. Bekannt geworden ist sie als „Ponzi-System“. Benannt nach unserem Charles, dessen voller Name Charles Ponzi lautete.
Während Charles Ponzi noch mehrfach ähnliche Betrügereien anzettelte, entwickelten weltweit Betrüger*innen diese Methode immer weiter. Bis heute fallen auch in Deutschland immer wieder Menschen auf Abwandlungen dieses Systems rein.
Bei uns kennen wir eher eine andere Variante, das sogenannte Schneeball- oder Pyramiden-System.
Alle haben einige Gemeinsamkeiten:
Ausschüttungen werden immer aus den Einlagen anderer finanziert. Und sie sind so angelegt, dass die Anzahl der Teilnehmer*innen exponentiell steigen muss. Sobald dieser Anstieg abbricht, kollabiert das System.
Die Stärke an diesem Konzept ist offensichtlich: Da die Pyramide nach unten immer breiter wird, steigt auch die Zahl an Interaktionen. Immer mehr Kund*innen werden angesprochen – ohne, dass sich die Pyramidenspitze persönlich engagieren muss.
Genau dieser Faktor (und nur dieser Faktor) interessiert uns in der politischen Teilhabe. Dialogische Formate der Bürgerbeteiligung leben vor allem davon, dass eben Dialoge stattfinden.
Sie sind es, die den Wert solcher Prozesse ausmachen. Miteinander zu sprechen, zu streiten, nach Lösungen zu suchen, ist die Grundlage von allem, was Beteiligung an positiven Effekten produzieren kann.
Ob Selbstwirksamkeitserfahrung beim Einzelnen oder Einvernehmen in Gruppen: Alles, was Beteiligung erreichen will, kann oder soll, beruht auf Dialog.
Deshalb sind Formate, die die Beteiligten in kleinen Gruppen in direkten Austausch bringen, so beliebt. Sie produzieren weitaus mehr Netto-Dialogzeit als Großgruppen, die einem Vortrag lauschen und dann Fragen stellen dürfen.
Doch das erschöpft noch lange nicht die Dialogpotentiale von Beteiligung. Am Beispiel von Bürgerräten wurde ermittelt, dass viele Mitglieder eines Bürgerrats eine zweistellige Zahl von Menschen im unmittelbaren Umfeld in den Prozess „integrieren“. Indem sie ihre Erfahrungen mit diesen teilen, Feedback bekommen, das sie wieder in ihre Beiträge einfließen lassen.
Ähnliche Effekte können auch bei anderen Formaten der Beteiligung beobachtet werden.
Doch das muss kein zufälliger „Beifang“ bleiben. Und erst recht nicht verhindert werden, indem man die Beteiligten zur Verschwiegenheit verpflichtet oder geschlossene Mehrtagesformate wählt.
Tatsächlich gibt es in einigen Institutionen die Tendenz, diese Begleitprozesse als Risiko- oder Störfaktor zu begreifen.
Das Gegenteil ist richtig.
Hier liegt eine Chance, die Netto-Dialogzeit dramatisch zu erhöhen. Und genau darum geht es ja.
Warum also Beteiligte nicht ganz bewusst dazu anregen, ihre Erfahrungen mit ihrem Umfeld zu teilen? Ihnen gar Tipps an die Hand geben? Fragebögen verteilen, die sie gemeinsam mit ihrem Umfeld besprechen und ausfüllen? Konkrete Formatanregungen mit auf den Weg geben?
All das ist möglich. Es bedarf ein paar Anpassungen im Prozessdesign. Aber die dialogische Ernte ist sensationell. Es gibt gute Erfahrungen in der Jugendbeteiligung, wo auf diese Art manchmal bis zu 80 % der Schüler*innen in einer Einrichtung in den Prozess integriert werden.
Und auch die Idee der „Wohnzimmerparlamente“ spielt mit diesem Konzept.
Wenn Beteiligte andere beteiligen, also selbst zu Beteiliger*innen werden, dann kann das zu einem echten Beteiligungsbooster werden.
Diese Form der pyramidalen Partizipation hat gänzlich andere Motive und Ziele als der alte Charles Ponzi oder moderne Anlagebetrüger*innen. Aber sie nutzt deren Konzept der exponentiellen Gewinnvervielfachung.
Nur ist die Währung in der Beteiligung eben eine andere. Sie heißt:
Dialog.