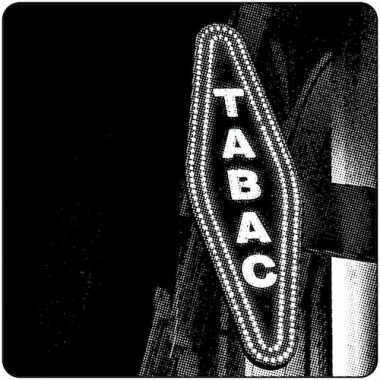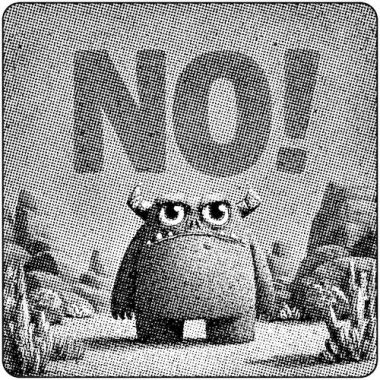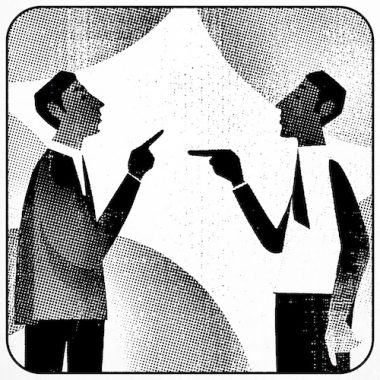Ausgabe #272 | 20. März 2025
Über Geld spricht man nicht
Der einzige Bäcker einer schwäbischen Kleinstadt hatte ein Problem. Wirtschaftlich ging es ihm gut. Sogar sehr gut.
Seine Bäckerei in der vierten Generation hatte einen guten Ruf. Der Kundenkreis war stabil. Und blieb es auch trotz der Aufbackware, die die Filialen eines Handelsriesen seit einiger Zeit anboten.
Über die Jahre war seine Familie wohlhabend geworden. Und der Bäcker ein großer Fan schneller Autos.
Also leistete er sich zu seinem sechzigsten Geburtstag tatsächlich eines von den schnellen roten italienischen Autos: Einen Ferrari.
Und weil er nicht nur wohlhabend war, sondern auch klug, mietete er für die Neuerwerbung eine Garage. In einer fast 60 km entfernten Stadt.
Jahre später wurde er in einem großen deutschen Nachrichtenmagazin zitiert, mit einem falschen Namen, wie er es erbeten hatte. Seine Aussage: „Wenn auch nur einer im Ort von dem Ferrari gewusst hätte, hätte ich meinen Laden zumachen können.“
Geld ist in Deutschland ein ziemlich tabuisiertes Thema. Wenn man es nicht hat. Aber auch und gerade, wenn man es hat. Wohlstand wird bei uns gerne versteckt.
Eines der bekannteren deutschen Sprichworte lautet: „Über Geld spricht man nicht.“
Es gilt als unangemessen, Finanzielles wie etwa Einkommen, Schulden oder eigenes Vermögen in der Öffentlichkeit zu thematisieren.
Das ist nicht nur in Deutschland so. Unser Sprichwort gibt es so oder so ähnlich auch in Frankreich, Italien und Großbritannien.
Geld ist ein hochsensibles Thema, auch wenn es gesellschaftlich relevant ist.
In den USA zum Beispiel ist es üblich, dass Präsidenten aber auch andere Spitzenpolitiker ihre Vermögensverhältnisse, ja sogar ihre kompletten Steuerunterlagen öffentlich machen.
Bei uns ist das unvorstellbar.
Selbst da, wo die Finanzen öffentlich sind, wie zum Beispiel bei den kommunalen Haushalten, sind sie kaum öffentliches Thema.
Kommunalhaushalte sind komplex, oft auch für Kommunalpolitiker*innen schwer zu verstehen. Doch das ist nicht der einzige Grund.
Das öffentliche Sprechen über öffentliche Haushalte ist auch etwas, was kulturell vor allem den Spitzen von Kommunalverwaltungen Unbehagen bereitet.
Erst recht dann, wenn diese nicht so wirklich rosig aussehen. Was sie in deutschen Kommunen selten tun. Der Zwang zum Sparen wird dann gerne betont. Der Blick auf die konkreten Details ist dann aber in der öffentlichen Debatte die große Ausnahme.
Das kann ein Grund dafür sein, dass sich Bürgerhaushalte in Deutschland nach wie vor etwas schwertun.
Und ein Grund dafür, dass sie zumeist in Form eines Bürgerbudgets daherkommen. Also nicht wirklich als tiefe Beschäftigung mit der kommunalen Einnahmen- und Ausgabenpolitik, sondern als fester Betrag, über dessen Ausgabe die Bürger*innen (mit) entscheiden können.
Und auch wenn dieser Betrag regelmäßig nur einen winzigen Bruchteil eines Prozents des Haushaltsvolumens darstellt, so reicht das in vielen Kommunen schon als Argument, um auch das nicht zu tun.
Im Rahmen eines Workshops mit Bürgermeister*innen zum Bürgerhaushalt hörte ich tatsächlich von allen Anwesenden, die keinen Bürgerhaushalt hatten, dieselbe Antwort:
Das können wir uns nicht leisten.
Besonders spannend vor diesem Hintergrund sind die Zahlen zu Bürgerhaushalten in europäischen Ländern.
Der „Participatory Budgeting World Atlas“ zählte im Jahr 2019 insgesamt 4.676 europäische Bürgerhaushalte, was fast 40 % der weltweit aufkommenden Bürgerhaushalte entspricht.
Die Verteilung allerdings ist bemerkenswert:
Die große Mehrheit der Bürgerhaushalte befindet sich nämlich in Osteuropa (46 %) und in Südeuropa (46 %). Nur ein sehr kleiner Teil der Bürgerhaushalte wird in Westeuropa (5 %) und Nordeuropa (2–3 %) umgesetzt.
Mit dem Argument „Einen Bürgerhaushalt muss man sich leisten können“, ist das so einfach nicht in Einklang zu bringen.
Die Motivlage ist tatsächlich eine andere, fragt man zum Beispiel Akteure in Polen und Portugal, zwei Länder, die bereits mit Bürgerhaushalten auf nationaler Ebene experimentiert haben.
In beiden Ländern, wie übrigens auch in einer Studie des Berlin Instituts für Partizipation, wird darauf verwiesen, wie positiv sich Bürgerhaushalte auf die Ausbildung von Vertrauen und dem gesellschaftlichen Zusammenhang auswirken können.
Andere Studien belegen einen Zusammenhang von Bürgerhaushalten und höherer Wahlbeteiligung.
Schon der erste Bürgerhaushalt der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts im brasilianischen Porto Alegre ist aus diesem Grund entstanden.
Wenn wir aktuell über die Frage diskutieren, wie wir mit Partizipation unsere Demokratie stärken können, dann sollten wir deshalb die Bürgerhaushalte nicht vergessen.
Denn wenn wir Zusammenhalt fördern wollen, dann sind es nicht die schnell beschlossenen Multimilliardenkredite, die uns helfen (so nötig sie je nach politischer Überzeugung sein mögen), sondern etwas anderes:
Wir sollten über Geld sprechen. Darüber, wie wir es einsammeln und wofür wir es ausgeben. In jeder Kommune, warum nicht auch in jeder Schule?
Überall da, wo öffentliche Gelder im Spiel sind, kann und sollte auch öffentliche Partizipation im Spiel sein.