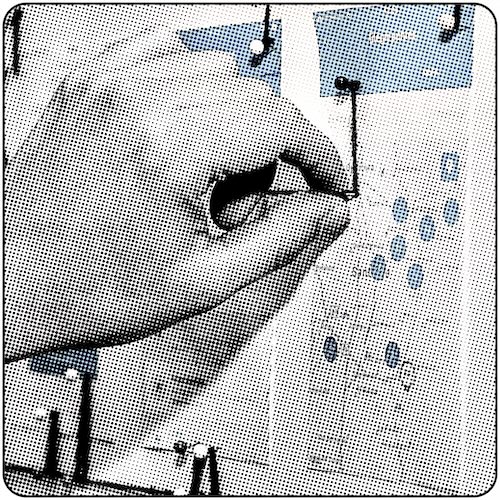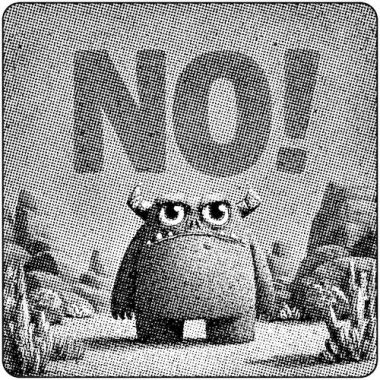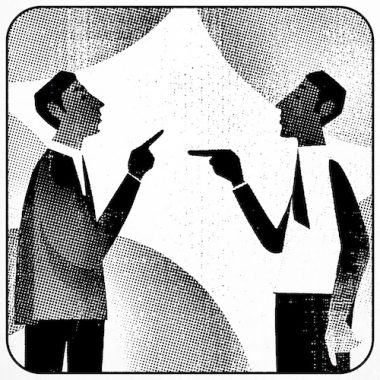Ausgabe #274 | 3. April 2025
Partizipation und Planbarkeit
Napoleon Bonaparte war Putschist, Diktator, Imperialist und Kriegsverbrecher.
Und doch soll er uns heute als Beispiel dienen.
Der Mann hatte neben seinen dunklen Seiten auch durchaus positiven Einfluss, sogar auf die Partizipation.
Denn er setzte in weiten Teilen Europas den sogenannten „Code civil“ durch, auch bekannt als „Code Napoleon“.
Damit wurden erstmals zahlreiche Bürgerrechte garantiert – und das im durchaus freiheitlichen Geist der Aufklärung.
Bis Napoleon so rechtliche Verbindlichkeit schuf, galt für einfache Bürger in vielen Regionen gar kein geschriebenes Recht. Oft waren sie eher Untertanen als Bürger.
Der neue Code civil garantierte allen Bürgern Freiheit, Gewerbefreiheit und freie Berufswahl, Gleichheit vor dem Gesetz und die vollkommene Trennung zwischen Kirche und Staat.
Allerdings waren damit insbesondere die männlichen Bürger gemeint.
Ähnlich wie schon in der attischen Demokratie waren wieder einmal nur die Männer „vollwertige Bürger“.
Und doch war es ein Fortschritt zum Untertanendenken.
Nun sind verbriefte Bürgerrechte noch lange keine Partizipation – aber sie sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin.
Selbst nach der Niederlage Napoleons galt der Code in vielen deutschen Gebieten weiter fort. Erst 1900 wurde der Code civil dort, wo er im Deutschen Reich noch galt, vom Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) abgelöst.
Sich mit den Wurzeln heutiger Beteiligungsansprüche in der juristischen Geschichte Europas zu beschäftigen wäre spannend, vermutlich aber vor allem für Juristen und Rechtsphilosophen.
Was uns in der heutigen Ausgabe unseres Newsletters an Napoleon interessiert, ist etwas ganz anderes. Auf den ersten Blick hat es mit Partizipation nichts zu tun. Doch das täuscht.
Sprechen wir über Napoleons Ruf als Militärstratege.
Napoleon galt als militärisches Genie. Er war bekannt dafür, dass er jeden Feldzug, jede einzelne Schlacht mit äußerster Genauigkeit und bis ins kleinste Detail intensiv plante.
Das brachte ihm das Image eines genialen Strategen ein.
Und doch verlief kein einziger seiner Feldzüge so, wie er es vorgesehen hatte.
Ein Widerspruch?
Nein. Denn Napoleon beherrschte die Dialektik von Planung und Improvisation perfekt.
Seine umfassende Planung – und das damit verbundene gründliche Durchdenken aller denkbaren Szenarien – waren für ihn die zentrale Grundlage dafür, im Bedarfsfall schnell und konsequent zu improvisieren.
Für Napoleon war Planung und Improvisation kein Widerspruch, sondern detaillierte Planung die Voraussetzung, um wirkungsvoll auf ungeplante Veränderungen reagieren zu können.
In seinem Denken war die Abweichung von einem mit viel Aufwand entwickelten Plan nie „Fehlerkorrektur“, sondern essenziell für den Erfolg.
Napoleon ging grundsätzlich immer davon aus, dass jeder Plan sich ändern wird. Immer. Und dass das eine Chance ist.
So. Jetzt sind wir bei der Partizipation.
Prozesse der politischen Teilhabe werden bei uns in Deutschland nämlich regelmäßig intensiv geplant. Das auch von mir in der Aus- und Fortbildung immer zentral gelehrte Beteiligungskonzept beschreibt diese detaillierte Planung. Und ich lege großen Wert darauf.
Um so erschrockener sind Studierende und Teilnehmende oft, wenn wir zum nächsten Schritt kommen, in dem es dann heißt:
Gute Konzepte haben keinen Bestand.
Denn noch mehr als militärische Pläne oder technische Abläufe großer Vorhaben ist Partizipation immer davon bestimmt, dass hier viele Menschen mit vielen Interessen, Erwartungen, Erfahrungen und Kompetenzen mitmischen.
Da ist es nicht nur nachvollziehbar, sondern ein Zeichen von Qualität, wenn es nicht genau so funktioniert, wie erwartet. Denn das zeigt: Die Beteiligten sind keine willenlosen Kunden, sondern eignen sich den Prozess an. Machen ihn zu ihrem Prozess.
Erst dann beginnt die wirkliche Partizipation.
Und wie bei Napoleon, wird es in der Beteiligung genau in diesem Moment spannend. Jetzt entscheidet sich, ob der Prozess eine Erfolgsgeschichte wird oder nicht.
Denn dieser Moment ist kein Fehler, sondern eine Chance.
Entwickelt wurde dafür der Begriff des „Lernenden Verfahrens“.
Dieses Lernen im Verfahren nicht als Unfall, sondern als Leistung zu betrachten, haben wir im großen Maßstab erstmals in der deutschen Endlagersuche eingeführt.
Als ich damals in der entsprechenden Kommission den Begriff des „Lernenden Verfahrens“ vorstellte, konnten die meisten Akteure damit nichts anfangen. Zwei Jahre später fand der Begriff sogar Eingang ins Gesetz.
„Lernendes Verfahren“ meint vor allem eines: Nicht nur die Möglichkeit zuzulassen, dass der Prozess sich anders ausgestaltet als geplant, sondern fest davon auszugehen, dass dies so sein wird.
Dafür müssen wir erkennen, wann es solche Veränderungsimpulse gibt.
Diese Impulse sind übrigens nicht zu übersehen: Sie manifestieren sich immer als Konflikte.
Diese können laut sein oder leise. Teilnehmerschwund, Motivationstäler, Pausen, in denen mehr gesprochen wird als im Plenum – all das deutet darauf hin, dass der Prozess sich den Beteiligten anpassen, dass er lernen muss.
In der Praxis gibt es eine Reihe von Ansätzen, um diese Impulse frühzeitig und positiv zu nutzen.
Wir unterscheiden zwischen drei unterschiedlichen Strukturen, die unsere Prozesse veränderbar machen.
Der personelle Ansatz arbeitet über eine konkrete Funktion oder Aufgabenbeschreibung. Gewährleistet werden kann dies durch eine konkrete Person oder ein Gremium.
Nicht immer braucht es ein „Nationales Begleitgremium“ wie in der Endlagersuche. Eine Projektbegleitgruppe oder eine Prozessbeauftragte in der kommunalen Fachstelle können das hervorragend leisten.
Diese Funktion ist im Prozess präsent, aber moderiert nicht. Sie ist ansprechbar für alle Beteiligte, aber auch für Beteiligende wie Auftraggeber, Fachämter, Kommunalpolitiker*innen u. a.
Damit diese Funktion ein lernendes Verfahren sicherstellen kann, braucht sie einige Rechte. Das Interventionsrecht sichert ab, dass sie sich jederzeit einmischen darf, auch ohne angerufen zu werden. Das Informationsrecht liefert die dafür nötigen Voraussetzungen. Das Besatzungsrecht garantiert, dass auch dann eine Beratung von Akteuren stattfindet, wenn sie diese nicht angefordert haben. Das „Freeze“-Recht ist eher selten, aber besonders bei Konfliktthemen hilfreich. Es ist die Möglichkeit, einen Prozess einzufrieren und erst wieder zu starten, wenn Nachjustierungen vorgenommen wurden.
Neben dem personellen Ansatz gibt es auch prozessuale Maßnahmen. Diese sind fest im Beteiligungskonzept integriert. Dazu gehören definierte Zwischenziele, die gemeinsam mit den Beteiligten geprüft und abgehakt werden. Auch begleitende Evaluationen mit Zwischenberichten sind eine Möglichkeit. Ebenso wie sogenannte „Rückversicherungsrunden“, in denen alle Beteiligten danach befragt werden, ob sie mit dem aktuellen Stand des Prozesses und dem geplanten nächsten Schritt gut klarkommen.
Personelle und prozessuale Tools widersprechen sich nicht. Sie können, ja sollen sich ergänzen. Funktioniert das, werden wir am Ende einen kulturellen Hebel haben. Das meint: Die kritische Hinterfragung wird von allen Akteuren als Pflicht und Recht gleichermaßen gesehen, Veränderungsimpulse nicht als Fehler, sondern als Zeichen von Qualität.
Dieser kulturelle Ansatz befürchtet keine Lernimpulse, er erwartet sie.
Denn am Ende geht es ja nicht nur darum, dass wir lernende Verfahren haben – sondern lernende Verwaltungen, lernenden Kommunalpolitik und lernende Beteiligte.
Gemeinsames Lernen ist eine wesentliche Eigenschaft von Guter Beteiligung.
Wollten wir das nicht, bräuchten wir sie nicht.