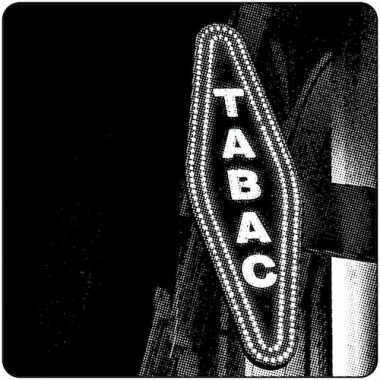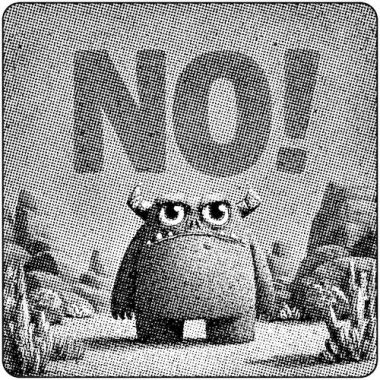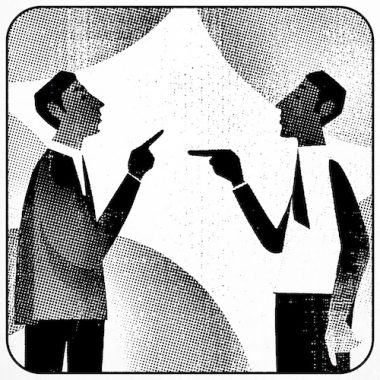Ausgabe #275 | 10. April 2025
Das Perlhuhn-Parlament
Tier-Dokus im TV sind beliebt. Es gibt unendlich viele von ihnen. Manche davon mit unfassbar großem Aufwand gedreht.
Sir David Frederick Attenborough sticht als Produzent hochwertiger Dokumentationen, die er im Auftrag der BBC produzierte, besonders hervor. Dutzende Preise sammelte er dafür ein.
Es gibt kaum einen aktuellen Tierfilmer, der nicht von ihm inspiriert wurde. Bei ihm ging es nicht nur um dramatische Bilder vom Fressen-und-gefressen-Werden. Er dokumentierte auch soziale Systeme in der Tierwelt.
Bei den Schimpansen stellt er zum Beispiel fest (O-Ton Attenborough):
„Das stärkste oder älteste, also befähigtste männliche Mitglied einer Herde schwingt sich zum Zugführer oder Leitaffen auf. Diese Würde wird ihm nicht durch das allgemeine Stimmrecht übertragen. Dem Starken gebührt die Krone: in seinen Zähnen liegt seine Weisheit.”
Demokratie im Tierreich? Kein Thema. Es sind die Stärkeren, die sich durchsetzen, gerade auch, wenn es soziale Strukturen gibt.
Das war lange unser Bild.
Doch so ganz stimmt es nicht.
Auch nicht bei Schimpansen. Sicher muss ein Alpha-Männchen stark sein, aber eben auch beliebt. Die Biologin Dr. Liran Samuni kennt spannende Geschichten:
Da gibt es in einer Gruppe ein Alpha-Männchen, dass nach erfolgreicher Jagd die Beute nicht zuerst fraß, sondern über eine lange Strecke zu den Weibchen seiner Gruppe trug – um mit ihnen zu teilen.
In einer anderen Gruppe war das weniger aggressive von nur zwei Männchen das Alpha-Tier. Immer wenn sein Konkurrent ihn attackieren wollte, kriegte er Ärger mit den Weibchen der Gruppe.
Wahlkampf? Bestechung? Unterstützung durch Parteistrukturen? Könnte man so interpretieren. Was allerdings offensichtlich ist:
Wenn es um die Führung in einer Gruppe geht, geht es nicht nur um Stärke, sondern auch um Rückhalt in der Gruppe. Um komplexe Prozesse. Bei Schimpansen wie bei Menschen.
Und manchmal erinnern sie ganz erstaunlich an Demokratie.
Die Geierperlhühner leben in der afrikanischen Savanne. Und sie haben ein Handicap: Sie sind auffällig und wenig wehrhaft. Die perfekte Zwischenmahlzeit für Löwen und andere Raubtiere.
Sie brauchen also die Gruppe, um überleben zu können. Und sie haben ein Alpha-Männchen. Das verhält sich ruppig, frisst zuerst, bedrängt andere. Der Boss also. Der, der die Entscheidungen trifft.
Sollte man denken.
Doch Forscher haben erstaunt herausgefunden, dass dieses Alpha-Männchen die Gruppe nicht anführt, sondern meist am Ende herumlümmelt.
Es sind die vermeintlich rangniedrigeren Tiere, die entscheiden, wohin die Gruppe sich bewegt, wo sie Futter und Sicherheit sucht. Der Prozess ist genau untersucht und diffizil, aber eines ist klar bei den Geierperlhühnern:
Die Mehrheit entscheidet!
Eine aktuelle Reportage des Deutschlandfunks hat eine Menge Beispiele dafür gesammelt.
„Fische sind viel bessere Demokraten als Menschen“, sagt Prof. Dr. Iain Couzin in der Reportage. Und er ist immerhin Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.
Die von ihm beobachteten Zebrafische haben eine bemerkenswerte Kompetenz.
Zum Beispiel bei der Suche nach Futter.
Wenn es zwei Futterquellen gibt, weiß das einzelne Tier höchstens von einer davon. Die Gruppe kennt aber beide und schwimmt zuverlässig zu der, die sich mehr lohnt. Etwa weil sie näher ist, oder mehr Futter bietet. Einen Anführer gibt es in diesen Gruppen nicht. Auch keine Hierarchie.
Jeder Richtungswechsel ist eine Abstimmung, jedes Tier trägt mit seinem Wissen und seinem Verhalten dazu bei.
Und doch ist auch diese Struktur nur bedingt stabil. Die Forscher führten ein spannendes Experiment durch:
Sie trainierten einen Teil der Gruppe zu „Extremisten“. Die einen lernen, einem blauen Licht zu folgen, um Futter zu erhalten, die anderen wurden auf ein gelbes Licht konditioniert.
Dann brachten sie „moderat“ blaue und „extrem“ gelbe Fische zusammen. Hatten sie nun die Wahl zwischen einem blauen und einem gelben Licht, war es nicht länger die Mehrheit, die sich durchsetzte, sondern die „radikalere“ Gruppe.
Irgendwie erinnert uns auch das an unsere Demokratie. Ganz besonders dort, wo dialogische Prozesse stattfinden, erleben wir das immer wieder.
Jene, die mit einer vorgefassten Meinung, durchsetzungsstark und wenig kompromissbereit in einen solchen Prozess gehen, setzen häufig mehr durch.
Vorurteilsfrei in einen Dialogprozess zu gehen – das wünschen wir uns von den Beteiligten.
Tatsächlich kann daraus aber oft ein Handicap für genau jene entstehen, die diesem Idealbild entsprechen.
Gute Beteiligung berücksichtigt das bei Methodenauswahl und Moderation.
Und in der Haltung.
Denn vor diesem Hintergrund kann es in Prozessen mit „extrem-gelben“ Akteuren sinnvoll sein, den Neutralitätsanspruch nicht starr, sondern kreativ auszuleben.
Indem sich die Moderation in besonderem Maße jenen verpflichtet fühlt, die moderat und offen in den Prozess gehen. Zum Beispiel, indem sie methodisch nivelliert, frühe Meinungsfestlegungen unterbindet, Arbeitsgruppen oder Kreativmethoden gezielt ein- und besetzt.
Es geht dabei nicht um Manipulation, sondern um Fairness. Und um qualitativ bessere Ergebnisse.
Denn genau das ist ja die Idee von Demokratie, Beteiligung und anderen Formaten der politischen Teilhabe. Ob bei Perlhühnern, Zebrafischen oder Menschen:
Das Wohl der Gemeinschaft steht im Zentrum. Und das generieren wir eben am besten auch gemeinsam.