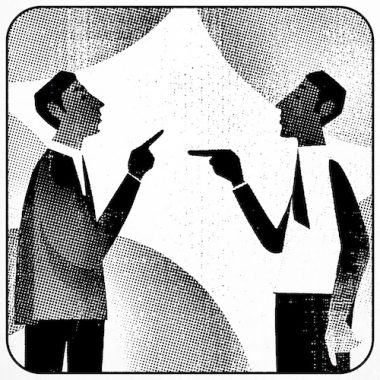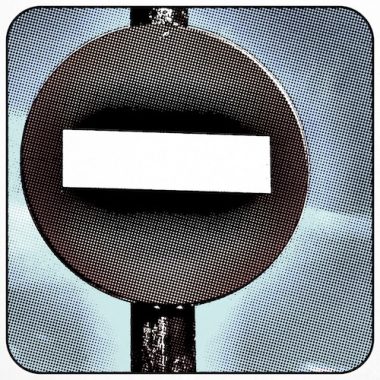Ausgabe #278 | 1. Mai 2025
Acht Stunden
81 Prozent der Beschäftigten wünschen sich eine Vier-Tage-Woche.
Nur wenige haben sie.
Doch die Zahl nimmt zu. Seit über einem Jahr sind 32 Stunden an vier Tagen auch in unserem Berlin Institut für Partizipation die Regel. Und sie hat sich bewährt.
Denn mehr Stunden bedeuten nicht unbedingt mehr Produktivität. Weniger Stunden allerdings führen zu mehr Lebensqualität.
Wenn wir heute also 32 Stunden in der Woche arbeiten oder es anstreben, muss uns eine andere Zahl komplett verrückt vorkommen: 72.
Das war die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Kaiserreich. Mehr als doppelt so viel plus ein Extra-Arbeitstag als unsere 32 Stunden von heute.
Kein Wunder, dass das Ringen um die Arbeitszeit die frühe Arbeiterbewegung prägte.
In den USA streikten heute vor exakt 139 Jahren rund 400.000 Arbeiter in mehreren Städten.
Der Tag war ein Samstag. Also ein regulärer Arbeitstag.
Sie forderten die Einführung eines Acht-Stunden-Tags. Üblich war damals noch eine tägliche Arbeitszeit von 12 Stunden – an sechs Tagen in der Woche.
Die Arbeitgeber warnten vor einem Ruin der Wirtschaft.
Sie reagierten mit Massenaussperrungen und versuchten die freien Stellen mit hungernden Migranten zu besetzen. Doch das gelang nur zum Teil.
Die Situation eskalierte, die Polizei und von den Arbeitgebern angeheuerte Schlägertrupps drangsalierten Kundgebungen und stürmten Versammlungen. Am 4. Mai explodierte bei einer solchen Aktion eine Bombe, die Arbeiter und Polizisten verletzte.
Das führte zu Ausschreitungen, die bis heute als Haymarket Riot bekannt sind. Dabei gab es Todesopfer bei Polizei und Streikenden.
Den Organisatoren auf Seiten der Arbeiter wurde der Prozess gemacht. Der deutschstämmige Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung, August Spies, wurde wie drei weitere Männer zum Tode verurteilt und exekutiert.
Es kam weltweit zu Protesten. In der Folge wurde der 1. Mai als „Kampftag der Arbeiterbewegung“ ausgerufen.
Am 1. Mai 1890 wurde dieser „Protest- und Gedenktag“ erstmalig mit Massenstreiks und Massendemonstrationen in der gesamten Welt begangen.
Es sollte noch lange dauern, bis der 1. Mai in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag wurde. Bei Gründung der ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden gelang es nur, den 1. Mai 1919 einmalig als Feiertag zu bestimmen.
Begangen wurde er dennoch Jahr für Jahr.
Deshalb waren die Nazis auch so perfide, genau am 2. Mai 1933 die
Gewerkschaftshäuser zu stürmen, das Vermögen der Gewerkschaften zu beschlagnahmen und sie gleichzuschalten.
Um den progressiven Anspruch dieses Tages gänzlich zu eliminieren, wurde ein Jahr später der 1. Mai durch eine Gesetzesnovelle zu einem „Nationalen Feiertag des deutschen Volkes“ erklärt.
Heute ist der 1. Mai in der Bundesrepublik Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Von der Umdefinition durch die Nazis hat er sich nie ganz erholt.
Zwar finden heute noch immer traditionelle Kundgebungen und Feiern der deutschen Gewerkschaften statt, an denen sich Jahr für Jahr Hunderttausende beteiligen.
Für weit mehr Menschen ist der 1. Mai jedoch vor allem ein willkommener freier Tag, der, anders als die meisten kirchlichen Feiertage, kaum Beschränkungen unterliegt – Komasaufen im öffentlichen Raum inklusive.
Egal wie wir unseren persönlichen 1. Mai gestalten – wir sollten nie vergessen, dass er eine lange Geschichte hat. Und dass es einer der wenigen Feiertage ist, die unmittelbar mit politischer Teilhabe verknüpft sind.
Heute ist nicht nur der Acht-Stunden-Tag durchgesetzt, auch die Partizipation in der Arbeitswelt ist gesetzlich garantiert.
Betriebsräte werden gewählt, haben starke Rechte und genießen hohen Schutz, Wirtschaftsausschüsse sorgen für Informationen, Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsvertreter in Aufsichtsräten gestalten mit.
Die Mitbestimmung in Deutschland ist stark. Beruht aber bislang ausschließlich auf repräsentativen Strukturen.
Außerhalb der Werkstore haben wir in den vergangenen Jahren viel Erfahrung mit dialogischer Beteiligung machen können. Es ist belegt, dass diese nicht nur Akzeptanz für notwendige Maßnahmen fördern, sondern auch das Miteinander stärken kann. Gerade in Zeiten des Umbruchs ist es wichtig, wirkungsorientierte Dialoge in und zwischen den gesellschaftlichen Gruppen zu führen.
Deshalb überrascht es nicht, wenn solche Formate und Prozesse zunehmend auch den Weg in die Arbeitswelt finden.
Denn dort finden gerade gewaltige Transformationsprozesse statt. Dreifach getrieben durch Digitalisierung, Klimawandel und Globalisierung heißt das für nahezu alle Unternehmen: Sie müssen sich wandeln.
Genau das ist die Stunde der Partizipation.
Vergangene Woche konnte ich darüber mit Michael Vassiliadis in einem längeren Gespräch diskutieren.
Michael Vassiliadis ist Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und Präsident der IndustriALL Global Union Europe. Die globale Gewerkschaftsföderation hat rund 50 Millionen Mitglieder.
Für den Gewerkschafter ist völlig klar: Die etablierten Mitbestimmungsstrukturen stehen nicht zur Disposition. Aber sie müssen gestärkt werden, eben auch durch partizipative Formate und Prozesse.
Die Gewerkschaften beginnen damit auch nicht bei Null. In der IGBCE wurde immer wieder mit Beteiligungsformaten experimentiert. Mit durchaus positiven Erfahrungen.
Seit zwei Jahren gibt es auch ein Kooperationsprojekt zwischen der IGBCE und dem Berlin Institut für Partizipation.
Das Projekt PIDA („Partizipation in der Arbeitswelt“) ermittelt Bedarfe, erforscht Strukturen und entwickelt Methoden zur Stärkung der Mitbestimmung durch erweiterte Partizipation.
Das ist kein Alleingang. Auch andere Gewerkschaften wie die IG Metall sind dran am Thema.
Und sie profitieren dabei von den Erfahrungen der Beteiligungsprofis in anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Nur wenig davon ist 1:1 übertragbar. Doch Partizipation folgt überall ähnlichen Pfaden und löst vor allem ähnliche Reaktionen aus.
Selbstwirksamkeitserfahrungen stärken Resilienz von Beteiligten und Institutionen – und vor allem auch der Demokratie.
Gerade die braucht es gerade dringend.
Über die Zukunft unserer Demokratie wird an den Wahlurnen entschieden. Vor allem jedoch in den Phasen dazwischen. Tag für Tag. In den Medien und Debatten. In den Kommunen und Schulen.
Und eben auch in den Betrieben.