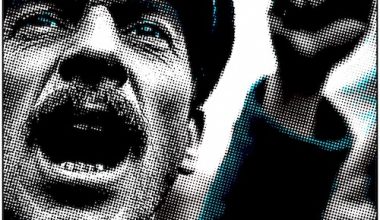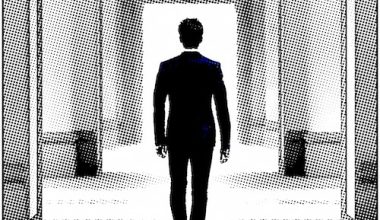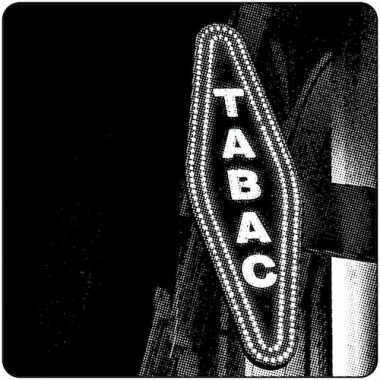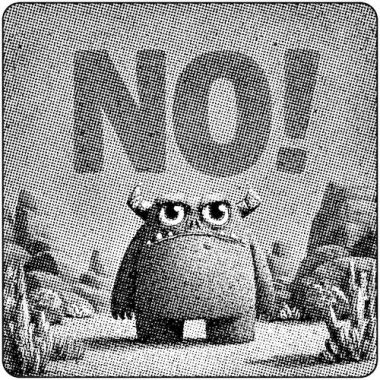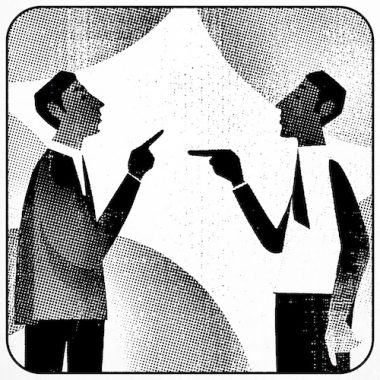Ausgabe #279 | 8. Mai 2025
Licht macht leise
Diese Zeilen schreibe ich, während ich etwas Dummes tue.
Heute ist der 8. Mai und ich sitze im ICE von Berlin nach München.
Zwei Städte. Ein Land. Und doch: Zwei Welten. Zwei Kulturen. Die eine innige Hassliebe verbindet.
Für einen Schwaben, der in Berlin lebt, aber an Tagen wie heute nach München reist, ist das immer wieder ein kleiner Clash der Kulturen.
Heute war es eher ein großer.
Denn wäre ich in Berlin geblieben, hätte ich heute frei gehabt.
Also so richtig frei.
In Berlin ist heute ein gesetzlicher Feiertag. So wie in Frankreich und anderen Ländern Europas.
Denn heute vor genau 80 Jahren, am 8. Mai 1945 endete die dunkelste Epoche der deutschen Geschichte.
In Berlin unterzeichneten die Oberbefehlshaber der Wehrmacht die Kapitulationserklärung.
Seitdem ist dies der Tag der Befreiung vom Faschismus.
In Mecklenburg-Vorpommern ist heute offizieller Gedenktag. Auch in Brandenburg und Thüringen. Ebenso in Hamburg. Auch in Schleswig-Holstein. Und in Bremen. Seit diesem Jahr auch in Sachsen. In Berlin in diesem Jahr sogar ein gesetzlicher Feiertag.
In Bayern?
Gar nix.
Und trotzdem fahre ich nach München.
Oder vielleicht gerade deswegen.
Denn in München startet heute die DIVE’25. Der Bundeskongress Design erwartet Hunderte Designer*innen aus Deutschland und dem Ausland.
In meiner Keynote spreche ich über Design und Partizipation, über partizipatives Design und darüber, dass Demokratie die Design-Branche braucht.
Wirklich dringend braucht.
Deshalb muss ich mit den Designer*innen über Demokratie reden.
Weil wir uns in einer Zeit befinden, die angstvolle Erinnerungen an diesen dunklen Teil der deutschen Geschichte hervorruft.
Schon einmal wurden die Frustrationen vieler Menschen erfolgreich in Hass umgelenkt.
Schon einmal zielte der Hass auf bestimmte, als fremd empfundene Bevölkerungsgruppen.
Schon einmal wurde von Umsiedlung und Remigration gefaselt.
Schon einmal wurde die Partei, die den Hass säte, nach langem Zögern als verfassungsfeindlich erkannt und bezeichnet.
1930 wurde ein Verbot der NSDAP diskutiert, aber nicht vollzogen. Damals erzielte die Partei bei den Wahlen 18,3 Prozent.
Drei Jahre danach schaffte sie die Demokratie ab.
2025 erzielte die AfD bei der Bundestagswahl 20,8 Prozent.
Seit einer Woche ist sie als verfassungsfeindlich eingestuft. Die überwiegende Meinung in politischen Kreisen ist aktuell: Man sollte es jetzt mit einem Verbotsverfahren „nicht überstürzen“.
Wir Demokratinnen und Demokraten streiten, ganz ähnlich wie vor knapp 100 Jahren, gerade darüber, wie wir mit denen umgehen sollen, die die Demokratie abschaffen wollen. Die Flüchtlinge entmenschlichen, Demokraten einschüchtern und Gesellschaft spalten.
Wir sollten aus der Geschichte lernen. Denn wer das nicht tut, läuft Gefahr, sie zu wiederholen.
Und die Lehre aus der Geschichte lautet: Faschismus ist keine Meinung. Faschismus ist ein Verbrechen.
Ein Verbotsverfahren gegen diese Partei ist fällig.
Eines aber ist es nicht:
Die Lösung des Problems.
Demokratie hat immer Feinde. Seit dem ersten Tag. In ihrer Geschichte gab es keinen Moment, indem ihr nicht nach dem Leben getrachtet wurde.
Doch Demokratien sterben nie an ihren Gegnern. Die sind nur die letztlichen Vollstrecker.
Und die können nur erfolgreich sein, wenn die Demokratie bereits schwerkrank darniederliegt. Weil die Menschen nicht mehr an sie glauben, mit ihr hadern, von ihr enttäuscht sind.
Wenn der Demokratie die Demokraten abhandenkommen, dann wird es ernst.
Knapp 40 Prozent der deutschen Bevölkerung sind laut einer neuen Studie mit der Demokratie unzufrieden.
In den neuen Bundesländern ist es sogar knapp mehr als die Hälfte der Befragten.
Besonders ausgeprägt ist diese Haltung in ökonomisch schwächeren Regionen, in denen die Menschen zugleich eine fehlende soziale Gerechtigkeit beklagen und Sorgen vor einem wirtschaftlichen und sozialen Abstieg haben.
Rund die Hälfte der Menschen in unserem Land finden das mit der Demokratie also gerade nicht so doll.
Weil sie kaum eine Chance haben, Demokratie wirklich zu erleben. So richtig. Mit Wirkung.
Denn es sind die demokratischen Selbstwirksamkeitserfahrungen, die Menschen dazu bringen, die Demokratie zu schätzen.
Und genau dafür sind Beteiligungsprozesse da.
Was vielen Beteiliger*innen aber kaum klar ist: Gute Beteiligungsprozesse haben ungeheuer viel mit Design zu tun.
Das fängt beim Informationsdesign an. Manch Einladung einer Kommune zu einem Beteiligungsprozess müssen selbst Akademiker zweimal lesen, um zu erkennen, dass es eine Einladung ist – und nicht die Androhung eines Bußgeldes.
Wer einfache Menschen erreichen will, muss einfache Sprache sprechen und schreiben. Das gilt nicht nur für Einladungen, sondern auch für Planungsunterlagen, Präsentationen und Tabellen.
Sprachdesign ist essentiell für eine inklusive Demokratie. Genauso wie das Design der Formate und Diskurse, ja selbst der Abstimmungen.
Wir wissen längst, dass Borda-Wahlen, Condorcet-Abstimmungen und systemisches Konsensieren viel tragfähigere Ergebnisse produzieren, als simple Ja/Nein-Abstimmungen.
Im Webdesign geht es weiter. Manche Beteiligungsplattformen haben eine Benutzerführung, deren Unzugänglichkeit nur noch vom Elster-Portal des Finanzamtes übertroffen wird. Dabei gibt es längst tolle Tools, die Partizipation zum Erlebnis machen.
Es gibt kaum einen Designbereich, der nicht partizipativ – oder eben exklusiv – gedacht werden kann.
Selbst das Lichtdesign hat Einfluss.
Studien haben längst belastbar bewiesen, dass eine schwächere Beleuchtung auch introvertiertere Typen eher dazu motiviert, sich aktiv am Diskurs zu beteiligen. Am anderen Ende der Skala ist am diskursfeindlichsten: Die Neonröhre.
Noch immer Standard in zu vielen deutschen Klassenzimmern.
Ganz vieles ist aber auch noch nicht erforscht, erprobt, erdacht.
Es gibt noch viel Spielraum für partizipatives Design, viel Wirkungsfantasie, viele Möglichkeiten und viel Bedarf.
Soll die Demokratie gestärkt werden, braucht sie vor allem eines: Mehr Demokraten.
Dazu braucht es mehr Selbstwirksamkeit.
Die kann nur entstehen, wenn wir mehr Partizipation haben.
Und die braucht politischen Willen, gesellschaftlichen Raum und:
Besseres Design.