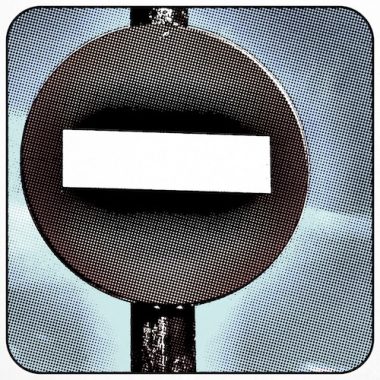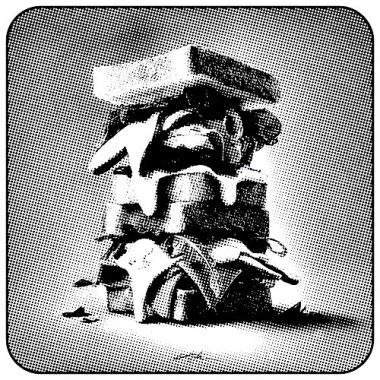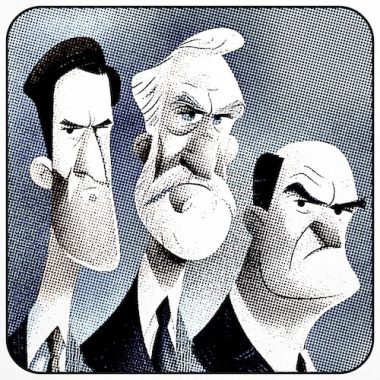Ausgabe #288 | 10. Juli 2025
Ich nicht!
Für manche ist es der beste Witz aller Zeiten. Doch Witze sind Geschmackssache.
Geschmacklose Witze waren das Markenzeichen der britischen Komiker-Truppe Monty Python. John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle und ihre (männlichen) Kollegen hatten ihre Blütezeit in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Sie waren bekannt für abgrundtief bösartige Sketche, chaotische Live-Auftritte und mehrere Kino-Filme, allesamt geprägt von absurdem Humor und Respektlosigkeit vor Tabus aller Art. Dabei lag hinter der Absurdität der Sketche nicht selten auch harsche Gesellschaftskritik verborgen.
Einer ihrer Sketche („Spam“, 1970), der sich über das typisch britische „Pressfleisch“ lustig macht, ist tatsächlich die Quelle dafür, dass unerwünschte Mailwerbung heute Spam genannte wird.
Legendär ist ihr Film „Das Leben des Brian“. Christentum, Judentum, aber auch palästinensische Organisationen bekamen ihr Fett weg.
Der Protagonist Brian, geboren zur selben Zeit wie Jesus von Nazareth, wird darin immer wieder für den Messias gehalten und schließlich gekreuzigt.
Gegen den kontroversen Inhalt des Filmes protestierten unter anderem britische und amerikanische konservative Christen. So nahmen manche Kinobetreiber den Film aus Rücksicht auf religiöse Empfindsamkeiten nicht ins Programm auf.
Und doch verdanken wir den eingangs erwähnten legendären Witz genau diesem filmischen Juwel.
Brian wird gegen seinen Willen als vermeintlicher Messias von zahlreichen Jüngern verfolgt und so lange bedrängt, bis er am Fenster einer Wohnung erscheint und eine kurze Rede hält.
Er versucht, seine Jünger davon zu überzeugen, dass es keinen Grund gibt, ihm zu folgen. „Es ist völlig unnötig, einem Menschen zu folgen, den ihr nicht mal kennt!“, ruft er ihnen zu. Doch das bleibt ohne Wirkung.
Schließlich probiert es anders. „Ihr seid alle Individuen“, ruft er.
Die Masse ruft wie mit einer Stimme zurück: „Ja! Wir sind alle Individuen!“.
Brian probiert es noch einmal: „Und ihr seid alle völlig verschieden!“.
Die Masse, wieder gleichzeitig: „Wir sind alle völlig verschieden!“.
Kurze Pause.
Dann eine einzelne schüchterne Stimme: „Ich nicht!“
Dieser Widerspruch zwischen Konformität und Individualität prägt nicht nur Teile des Films, er prägt auch unsere moderne Gesellschaft.
Lange war dieser Konflikt so konnotiert, dass man dem Zwang zur Konformität einen Hang zur Individualität entgegensetzte. Und das stimmte auch häufig und lange Zeit, gerade in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Während die Älteren noch stark von identitären Gesellschaften mit starkem kollektivem Druck beeinflusst waren, erkämpften sich die 68er und nachfolgende Generationen immer mehr individuellen Spielraum.
Doch diese Entwicklung hörte nicht auf. Heute erkennt zum Beispiel der Soziologe Andreas Reckwitz einen Zwang zur Individualität. Früher ging es vor allem darum, nicht aufzufallen und möglichst das Gleiche wie die anderen zu haben. Heute herrscht eine Logik des Besonderen, ein Streben nach Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit, das zu einer gesellschaftlichen Erwartung geworden sei.
So viel Individualismus funktioniert aber auf Dauer nicht.
Deshalb führt das nach Reckwitz zu immer neuen Umwertungen, Abwertungen und Entwertungen. Das äußert sich eben auch in der Erosion vermeintlich gemeinsamer Werte („Was als Wert gilt, bestimme ich“).
Individualität und Egoismus werden zu Massenphänomen und karikieren sich so selbst.
Das prägt nicht nur unsere Gesellschaft. Es sorgt auch sofort für Konflikte, wenn irgendwo irgendetwas am Status Quo verändert werden soll.
Vorhaben ohne Widerstand sind kaum noch denkbar. Ob Windrad, Strommast oder nur der Wegfall von drei Parkplätzen: Was immer in das Leben von Individuen eingreift, sorgt für Konflikte.
Aus diesem Grund nehmen Beteiligungsangebote zu. Das ist nachvollziehbar. Und richtig.
Aber nicht so einfach.
Denn Beteiligung, ganz besonders dann, wenn sie die richtigen zum richtigen Thema erreicht, hat dann genau mit jenen Individuen zu rechnen, die in ihrer ganz eigenen Welt leben wollen.
Das sorgt für Frust, auch bei den Beteiligern. Nun bietet man schon partizipative Extra-Schleifen an, investiert Zeit, Geld und Nerven. Und statt sich auf gemeinsame Interessen zu konzentrieren, gibt es ein Chaos aus individuellen Wünschen, Werten und Wirklichkeiten.
Da liegt es nahe, das als Defekt, als Problem, als Fehlentwicklung zu betrachten.
Ist es aber nicht.
Wenn wir beteiligen, weil unsere Gesellschaft individueller wird, dann steht die Kollision dieser Individuen im Mittelpunkt der Beteiligung.
Es ist ihre Aufgabe, sie zu ermöglichen, sie sichtbar zu machen – und damit bearbeitbar.
Gute Beteiligung lässt sich deshalb Zeit und Raum für Konflikte. Sie hält sie nicht nur aus. Sie braucht sie. Weil der Ausgleich individueller Interessen nur dann seriös Thema werden kann, wenn diese Interessen selbst Thema werden.
Am Ende sind Beteiligungsprozesse dann chancenreicher, erfolgreicher und auch effizienter, wenn sie Konflikte so früh und so klar wie mögliche sichtbar machen.
Die Idee, genau das zu vermeiden, um die „Gemeinsamkeit“ in den Mittelpunkt zu stellen, ist verlockend.
Doch sie ist eine Versuchung.
Für das Design von Beteiligungsprozessen heißt das: Das Ziel heißt nicht, Konflikte zu vermeiden, zu verdecken oder zu verzögern. Das Gegenteil trifft zu.
Genau dann, wenn Konflikte früh zur Sprache kommen, leistet Beteiligung genau das, was ihre Aufgabe und Existenzberechtigung ist. Und das heißt:
Wir haben etwas richtig gemacht …