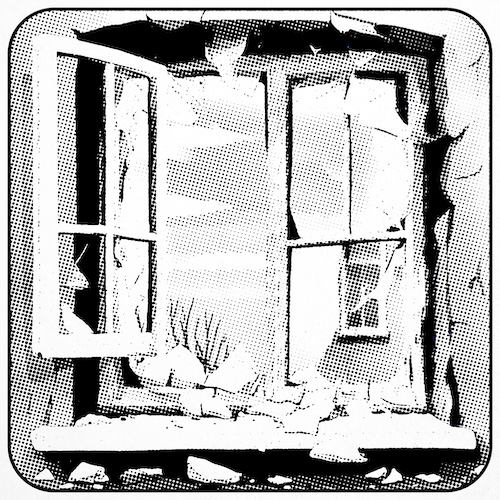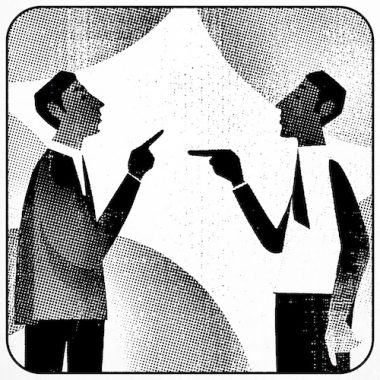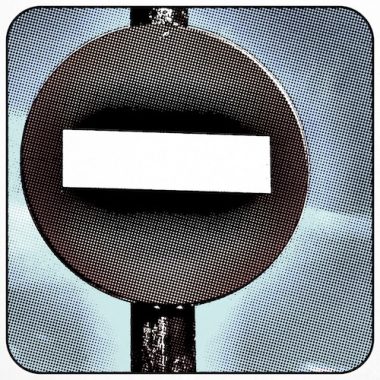Ausgabe #291 | 31. Juli 2025
Kaputte Fenster
Alexander Sutherland Neill war eine Ikone der Reformpädagogik. 1921 gründete er die experimentelle Summerhill School.
Zu einer Zeit, in der bedingungslose Autorität und exzessive Prügelstrafen im englischen Schulsystem noch zur Tagesordnung gehörten, baute er eine „freie“ Schule auf.
Neill wollte Kindern ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben mit Freiräumen für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ermöglichen. Sie sollten weder den Erwartungen ihrer Eltern noch, denen einer anderen Autorität entsprechen müssen.
Das erforderte umfangreiche Partizipation.
In Summerhill standen daher Schüler*innen und Lehrende auf einer Ebene. Innerhalb des Internats und den Werkstätten geltende Regeln wurden gemeinschaftlich und gleichberechtigt in regelmäßig stattfindenden Vollversammlungen verhandelt, abgestimmt und festgelegt.
Eine strikte Einteilung in Klassenstufen nach Alter gab es nicht und über die Teilnahme am Unterricht entschieden die Schüler*innen selbst. Neill war überzeugt, dass Kinder lernen wollen und sich das Lernklima verbessert, wenn sie die Möglichkeit erhalten, eine eigene Entscheidung zu treffen. Es gab keine Hausarbeiten, Zensuren oder Prüfungen.
Dass das nicht immer gut funktionierte, überrascht nicht. Denn hinzu kam: Die meisten seiner Schüler waren zuvor im klassischen Schulsystem krachend gescheitert, viele galten als asozial und nicht „beschulbar“.
Entsprechend kreativ musste Neill sein, wenn es um die Integration von neuen Schülern in das freiheitliche System vom Summerhill ging.
In einem seiner Bücher beschrieb er eine solche Situation: Ein neuer Schüler galt als „schwer erziehbar“ und gewalttätig. Er war kaum angekommen, da fing er an, immer wieder Fensterscheiben der Schule mit Steinen einzuwerfen.
Als Neill das mitbekam, suchte er den Jungen und ertappte ihn bald darauf auf frischer Tat, mit einem Stein in der Hand.
Der Junge sah Neill an. Und warf dann die Scheibe ein. Er wartete auf eine Reaktion, doch Neill nickte ihm nur zu. Der Junge suchte einen weiteren Stein und warf ihn auf die nächste Scheibe.
Neill kramte einen Geldschein aus der Tasche und reichte ihn dem Jungen. Er versprach einen weiteren Schein für jede weitere kaputte Scheibe.
Das verwirrte den Jungen so sehr, dass er sich trollte.
Neill beschreibt weiter, wie es ihm im Anschluss gelang, eine Beziehung zu dem Neuankömmling aufzubauen – und wie geduldig die anderen Schüler damit umgingen, dass sie eine Weile kalte Schlafzimmer hatten.
Denn ihre Erfahrungen mit gemeinschaftlicher Selbstregulierung stärkte auch ihre Toleranz und Integrationsfähigkeit.
Die Methode, die Neill anwendete, hat einen Namen: Paradoxe Intervention.
Unter einer paradoxen Intervention versteht man eine Handlung, die in scheinbarem Widerspruch zum angestrebten Ziel steht.
Eingesetzt wird die Methode u. a. in der Psychotherapie.
Der Ansatz ist aber auch sehr gut geeignet, um partizipativ Konflikte zu bearbeiten.
Im Kontext von Gruppenprozessen, Projektarbeit oder Mediation kann sie helfen, Probleme sichtbar zu machen, Blockaden zu lösen und Handlungsoptionen zu entwickeln.
Der Ablauf ist im Grunde recht einfach. Zu Beginn entwirft die Gruppe gemeinsam das denkbar schlechteste Ergebnis des aktuellen Projekts, Prozesses oder Konflikts.
Dieses Worst-Case-Szenario darf übertreiben, dramatisieren und bestehende Regeln ignorieren. Das Ziel ist maximale Konfrontation mit dem Scheitern.
In einem zweiten Schritt erfolgt eine Art Rückwärtsplanung. Ausgehend vom Worst-Case wird in Etappen zurück in die Gegenwart gedacht: „Was muss passiert sein, damit es so schlimm kommen konnte?“
Für jeden Teilschritt wird ein konkreter Vorläufer identifiziert. So entsteht eine Chronologie des Scheiterns, die Ursachen, Dynamiken und Versäumnisse sichtbar macht.
Für jeden dieser Schritte werden nun die Rahmenbedingungen, Strukturen, Denkweisen oder Verhaltensmuster identifiziert, die das negative Szenario möglich gemacht haben.
Mögliche Leitfragen dafür sind: Welche Entscheidungen wurden systematisch vermieden? Welche externen Einflüsse wurden falsch eingeschätzt? Wie wurde miteinander kommuniziert oder gerade nicht?
Aus der Analyse wird nun ein gemeinsamer Aktionsplan entwickelt. Die Leitfragen hier lauten: Was sollte vermieden werden? Welche Schutzmaßnahmen sind sinnvoll?
Diese Methode funktioniert ausgezeichnet, wenn ernsthafte Konflikte vorliegen, die ein hohes Eskalationspotential haben. Allerdings muss sie zu einem Zeitpunkt eingesetzt werden, in dem die Beteiligten (noch) bereit sind miteinander zu sprechen.
Dann aber ist die paradoxe Intervention ein starkes Tool. Nicht nur für Konflikte in der Gruppe, sondern auch für Themen mit Konfliktpotential.
Erst kürzlich durfte ich als externer Experte eine Veranstaltung im Auftrag der Europäischen Union begleiten, bei der sich Bürgerinnen und Bürger mit Ideen zur Stärkung der Demokratie beschäftigten.
Auch hier kam eine Variante der Methode zum Einsatz: Zunächst wurde untersucht, warum gängige Ideen der Demokratiestärkung im Jahr 2030 gescheitert sein werden – um dann auf dieser Grundlage kreative neue Ideen zu entwickeln.
Eingesetzt wurde die paradoxe Intervention auch schon bei Themen wie kommunaler Klimaresilienz, öffentlicher Gesundheitsfürsorge und – da schließt sich der Kreis – der Reform unseres Bildungssystems.
Das hätte kreative Ideen bitter nötig. Heute wird in Schulen zwar nicht mehr körperlich gezüchtigt. Aber ansonsten hat sich in den vergangenen 100 Jahren das Konzept des freien Lernens nicht wirklich durchsetzen können.
Insofern ist nicht sicher, ob es eine ausschließlich gute Nachricht ist, dass Summerhill auch nach über 100 Jahren noch existiert.
Und noch immer als Experimentalschule gilt …