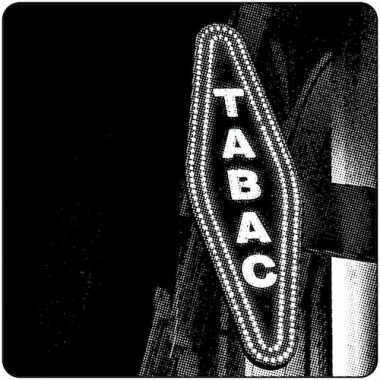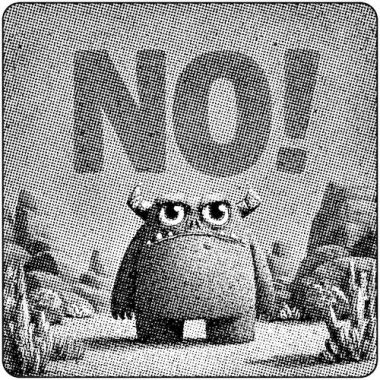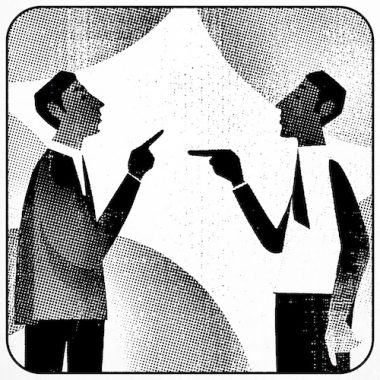Ausgabe #293 | 14. August 2025
Strategische Verunsicherung
Der Film „Konklave“ war international erfolgreich. Er wurde für acht Oscars nominiert. Ausgezeichnet wurde letztlich das Drehbuch.
Selbst in der katholischen Kirche gab es Lob. Ein offizielles Medium schrieb, er sei „nah an der Realität“. Und das bei einem Film mit Dialogen wie diesen:
„Niederlage? Dies ist ein Konklave, kein Krieg.“
„Wir sind in einem Krieg. Und du musst dich für eine Seite entscheiden.“
Der Film ist aus vielen Gründen sehenswert, nicht zuletzt wegen seiner überraschenden Pointe am Ende.
Auch, weil er eine Menge Charakterstudien und Gruppendynamik präsentiert.
Im Fokus steht dabei der Kardinal Lawrence. Er ist mit der schwierigen Aufgabe betraut, die Wahl des neuen Papstes zu koordinieren. Schon zu Beginn nur widerwillig seine Pflicht erfüllend, gerät er zunehmend in ein Dickicht aus unergründlichen Machtspielchen.
Ohnehin in seinem Glauben an die Kirche geschwächt, bestärkt ihn der Blick auf die Machenschaften in seinem Zweifel, ob die Kirche wirklich noch Gott dient – oder nicht vielmehr ihrem eigenen Machterhalt.
Prägend ist eine Szene, in der er sich mit der Frage der Gewissheit auseinandersetzt: „Die größte Sünde ist die Gewissheit.“
Und weiter: „Sie ist der große Feind der Einheit. Sie ist der Todfeind der Toleranz.“
Man möchte ergänzen: „… und der Demokratie.“
Denn wer Gewissheit hat, dass er im Recht ist, der braucht keine Wahlen, Abstimmungen oder politischen Gegner. Alle stehen bei der Realisierung der richtigen Ziele nur im Weg.
Und wer Gewissheit hat, der braucht auch keine Beteiligung. Wer den perfekten Plan entwickelt hat, ein Vorhaben bestmöglich ausgestaltet, wer klar weiß, was die Menschen wollen und was gut für sie ist, der muss sie nicht beteiligen, ja nicht einmal fragen.
Gewissheit in deutschen Planungsbüros, Ämtern, Verwaltungen und Parteigremien verhindert zu oft gute, tiefe, umfassende, wirksame Beteiligung.
Das schwächt Akzeptanz und Zusammenhalt, selbst dann, wenn die Gewissheit richtig liegen sollte. Tut sie das nicht, was eher die Regel als die Ausnahme ist, dann ist es noch schlimmer.
„Sei ungewiss!“, ist deshalb ein Rat, den man Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung gerne geben möchte. Denn Ungewissheit fördert Fragen, Suchen, Dialoge und Beratungsoffenheit.
Kein Plan ist perfekt. Immer könnte er besser sein. Genau das ist die Haltung, die Beteiligung und damit Demokratie fördert.
Das gilt für die Frage, OB zu einem Thema oder Vorhaben beteiligt werden sollte.
Es gilt aber auch für die Haltung, mit der Beteiligung geplant, organisiert, moderiert und ausgewertet werden sollte.
Wer in einer Beteiligung seinen Plan voller Gewissheit präsentiert, überzeugt vielleicht einige. Viele aber werden frustriert. Manche fühlen sich gar provoziert. Selbst, wenn man mit dieser Haltung durchkommt, nutzt es nichts.
Die Chance, aus der Beteiligung zu lernen, ist vertan.
Die Gewissheit ist also der Feind guter Beteiligung. Und das doppelt: Sie verhindert manche Beteiligung, und sie kann in der Beteiligung destruktiv wirken.
Tatsächlich ist Gewissheit nicht nur ein doppeltes Risiko, sondern ein Dreifaches.
Denn es ist nicht nur die Gewissheit auf Seiten der Entscheider*innen und Beteiliger*innen, die Beteiligung ins Stolpern bringen kann.
Auch Beteiligte können mit Gewissheiten im Gepäck anrücken. Oft mit sehr unterschiedlichen Gewissheiten. Manchmal auch mit offensichtlich unbegründeten Gewissheiten.
Das macht Beteiligung herausfordernd. Denn im Idealfall produziert sie ja nicht nur ein Ergebnis mit maximalem Einvernehmen, sondern auch mit einem hohen Grad an Gewissheit der Beteiligten.
Niemand wünscht sich ein Beteiligungsergebnis, von dem die Beteiligten sagen:
„Darauf haben wir uns geeinigt. Ob’s eine gute Lösung ist? Keine Ahnung.“
In der Beteiligung sprechen wir von „Ambivalenz der Gewissheiten“. Je mehr gemeinsame Gewissheit am Ende vorliegen soll, desto mehr müssen wir uns damit beschäftigen, im Prozess einzelne Gewissheiten zu hinterfragen.
Gar zu zerstören.
Das widerspricht ein wenig dem oft gehörten Ansatz, gleich zu Beginn eines Beteiligungsprozesses durch „Aufladen“ mit Fakten und Informationen, Gewissheiten quasi als gesetzt ins Spiel zu bringen.
Doch so einfach ist das nicht.
Gewissheit fällt nicht vom Himmel. Sie ist auch kein Ergebnis von Belehrung, gar noch mit Fakten, die man gar nicht hören will.
Gewissheit entsteht in einem Prozess.
Und der beginnt: Mit der Erkenntnis von Ungewissheit.
Gewissheit muss man erlangen wollen, wer glaubt, sie schon zu besitzen, lässt sich darauf nicht ein.
Deshalb ist, so irritierend es klingt, der beste Beginn eines gemeinsamen Beteiligungsprozesses: Die Zerstörung von Gewissheiten.
Das Konzept der strategischen Verunsicherung sieht deshalb eben nicht vor, vermeintlich unkritisierbare Fakten zu kommunizieren und von allen Beteiligten deren Akzeptanz zu erwarten. Das funktioniert nur selten und so gut wie nie bei allen. Wenn es funktioniert, fehlen möglicherweise wichtige Gruppen.
Es geht um Fakten. Ja. Aber durchaus um Fakten, die sich widersprechen, die gegenteilige Schlüsse zulassen, die kein offensichtlich „einzig Richtiges“ Ergebnis formatieren.
Fakten, Folgen und Kausalketten dürfen, ja müssen am Beginn eines Beteiligungsprozesses auf den Tisch. Aber eben so, dass wir in der Gruppe mit einem gemeinsamen Sokrates-Moment beginnen. Das ihm zugeschriebene Zitat: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“, ist kein Zustand, den wir in Reinkultur erreichen müssen.
Dass wir aber unsere Gewissheiten erschüttert sehen, das ist eine ganz ausgezeichnete Voraussetzung dafür, sich gemeinsam, wertschätzend und offen auf die Suche nach Lösungen zu begeben.
Einvernehmen ist ein wichtiges Ziel der Beteiligung. Gemeinsam erarbeitete Gewissheiten aber auch.
Die Ungewissheit ist nicht nur der Freund der Beteiligung. Sie ist ein wichtiges Instrument.
Ein Instrument, das selten von Anfang an bereit liegt.
Sondern eines, dass wir uns gemeinsam erschaffen müssen.
Um es dann nutzen zu können.