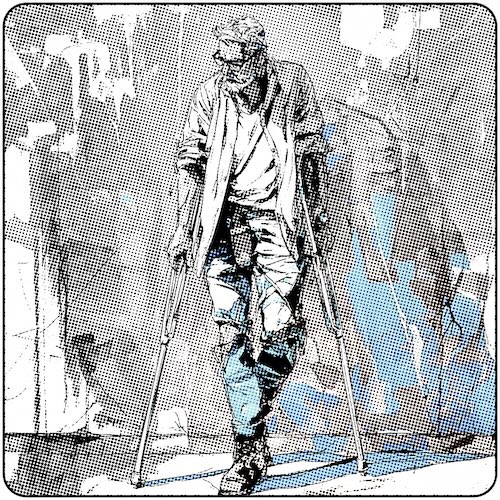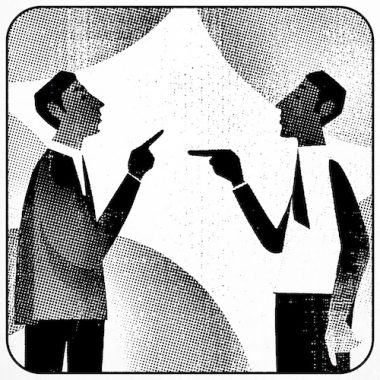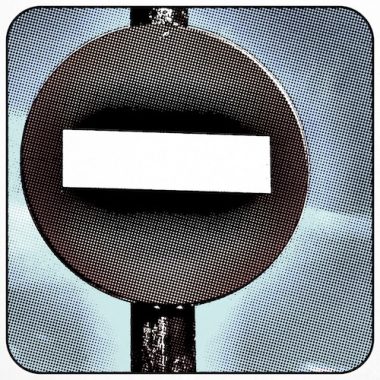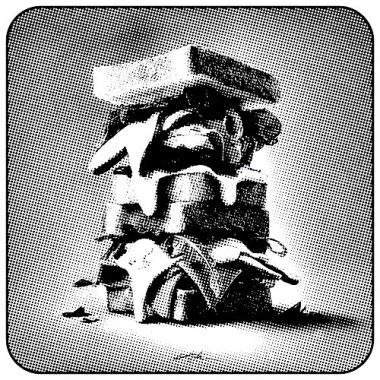Ausgabe #297 | 11. September 2025
Reha heißt das Zauberwort
Als die Kommunikationsprofis der Deutschen Rentenversicherung einen Titel für den aktuellen Jahresbericht finden sollten, dachten sie sich vermutlich:
Hipp muss es diesmal sein.
Während bisherige Berichte noch sperrige Titel trugen wie: „Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung im Licht der Statistik“, entschied man sich diesmal für einen mutigen Sprung:
„Reha heißt das Zauberwort“.
Auf über 100 Seiten lesen wir, wie sich die Rehabilitation in Deutschland entwickelt hat.
Knapp 1 Million Reha-Maßnahmen werden pro Jahr von der Rentenversicherung finanziert. Über 7,6 Milliarden Euro wurden für Reha-Leistungen ausgegeben. Das ist viel Geld.
Warum tun wir das?
Wir wissen, dass Erkrankungen, physische und psychische Krisen zwar überwunden werden können. Wir wissen aber auch, dass danach nicht von allein alles wieder so sein wird, wie vor der Krise. Reha setzt genau hier an. Sie soll Menschen dabei helfen, wieder so fit zu werden, wie irgend möglich.
Ohne Reha würde nicht nur die Rate von Wiedererkrankungen steigen. Die Betroffenen hätten auch ein erhöhtes Risiko, bei zukünftigen anderen Erkrankungen mehr Schaden zu nehmen.
Deshalb ist Reha das „Zauberwort“.
Man könnte auch sagen: Reha macht nach Krisen resilienter.
Da lohnt es sich doch, einmal einen Blick von den persönlichen Krisen auf gesellschaftliche Krisen zu richten.
Denn davon haben wir genug. Ob gefährdete Sozialsysteme, ruckelige Energiewende, Sorge um mögliche Kriegsszenarien, stärker werdende rechtsradikale Akteure in Gesellschaft und Parlamenten: Krisen an allen Ecken.
Immer wieder werde ich bei Vorträgen und auf Podien gefragt: Was kann Partizipation hier leisten?
Eine Menge.
Wenn man sie ernst nimmt.
Tatsächlich kann Beteiligung an vielen Stellen dabei helfen, Krisen so zu bewältigen, dass die Demokratie gestärkt daraus hervorgeht.
Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie Krisen Demokratie schwächen können. Korruption in der Maskenbeschaffung, als willkürlich empfundene Einschränkungen, Beschimpfung von Kritikern als „Covidioten“. Vieles ist schiefgelaufen.
Vieles wurde auch richtig gemacht. Nicht ohne Grund sind wir in Deutschland im internationalen Vergleich recht gut durch die Pandemie gekommen.
Und doch hat es gewaltige Verwerfungen gegeben und unsere Demokratie unter dem Strich geschwächt. Auch, weil Partizipation weder in noch nach der Krise wirklich eine Rolle spielte. Tatsächlich wurde die Beteiligung in den meisten deutschen Kommunen im Lockdown sogar auf null runtergefahren, wie eine Studie des Berlin Instituts für Partizipation zeigt.
Wäre es auch anders möglich?
Sicher.
Doch die richtige Partizipationsstrategie hängt davon ab, um welche Art von Krise es sich handelt.
Wir haben zum einen die langfristigen „Zeitlupen-Krisen“. Sie kündigen sich lange an, eskalieren langsam, können irgendwann einen Kipppunkt erreichen. Klimakrise, Rentensicherheit, Staatsfinanzen sind solche Krisenthemen.
Eine andere Form von Krise hatten wir in der Corona-Pandemie. In atemberaubenden Tempo waren tiefgreifende Entscheidungen nötig. Solche „Blitz-Krisen“ erfordern entschiedenes, schnelles staatliches Handeln. Für Verhandeln bleibt da wenig Raum.
Ganz anders bei den Zeitlupen-Krisen. Auch hier ist entschiedenes Handeln nötig. Doch es gibt Raum für reflektierte Entscheidungen und Partizipation.
Hier macht Beteiligung nicht nur Sinn. Sie ist auch absolut notwendig. Weil nur so Lösungen gefunden werden können, die gesellschaftliche Lasten gerecht verteilen – vor allem aber auch breit akzeptiert werden.
Werden Lösungen beteiligungsfrei von wenigen Akteuren als politische Verhandlungsmasse behandelt, werden sie weder gut noch breit akzeptabel – und schwächen die Demokratie.
Um im Jargon der Rentenversicherung zu bleiben: Das Zauberwort in Zeitlupen-Krisen heißt Partizipation.
Kommen wir zu den Blitz-Krisen. Da wird es herausfordernder. Antworten müssen schnell gefunden werden, manchmal in wenigen Tagen. Und oft sind sie (Stichwort Impfpflicht) davon abhängig, dass alle mitmachen.
Freiwillig oder unfreiwillig.
Ob Impfpflicht bei Seuchen, Ausgangssperren bei nächtlichem Stromausfall, noch härtere Eingriffe bei terroristischen oder militärischen Attacken – die Idee hier erst noch eine Beteiligungsrunde mit den Betroffenen zu drehen erscheint absurd.
Da braucht es Handeln des demokratischen Staates und seiner autorisierten Repräsentanten. Genau dafür haben wir sie gewählt.
Und alles in allem hat gerade auch Corona in Deutschland gezeigt:
Demokratie kann Krise.
Aber jede Krise produziert Frustrationen und Verwerfungen. Und schwächt so die Demokratie.
Erinnern wir uns an das eingangs beschriebene Konzept von Rehabilitation: Ohne sie wird die nächste Krise weiteren Schaden anrichten. Und die übernächste noch mehr …
Viele Milliarden Euro investieren wir Jahr für Jahr, damit das bei individuellen Krisen nicht geschieht.
Doch bei den gesellschaftlichen Krisen ignorieren wir diese Herausforderung regelmäßig.
Reha heißt das Zauberwort.
Auch und gerade für unsere Gesellschaft.
Es gibt Krisen, bei denen ist aufgrund unmittelbaren Handlungsdrucks wenig Partizipation möglich. Um so wichtiger ist eine gemeinsame, partizipative Reha.
Dabei geht es – wie in der medizinischen Reha auch – nicht darum, Schuldige zu finden, Verurteilungen zu formulieren. Es geht darum, den Organismus so fit zu machen, dass er die nächste Krise besser übersteht.
Denn die nächste Krise kommt bestimmt.
Übrigens, aus der Medizin wissen wir: Eine Reha sollte zügig nach der Krise kommen. Aber auch eine späte Reha ist sehr viel besser als keine Reha.
Beim Thema Corona heißt das übrigens: Ein bisschen mehr als eine Enquete-Kommission im Bundestag darf es dann schon sein.