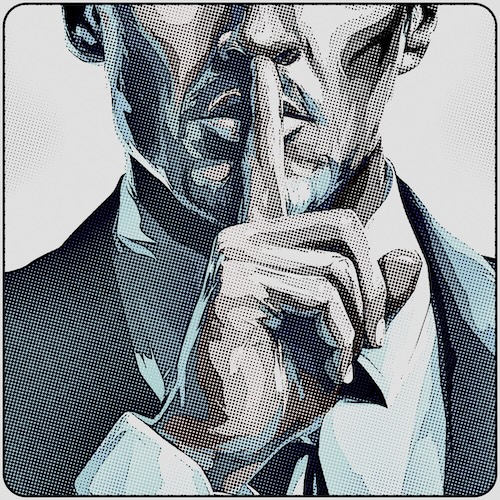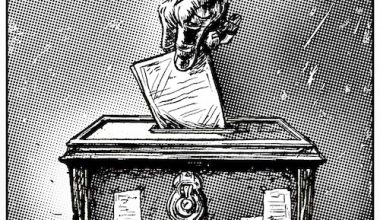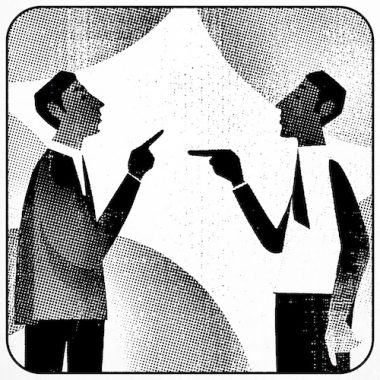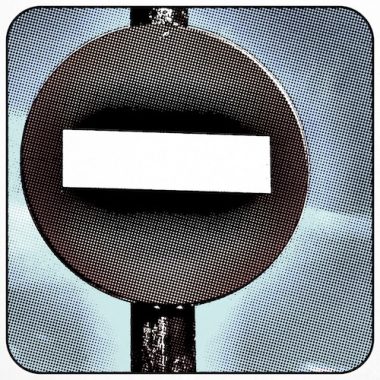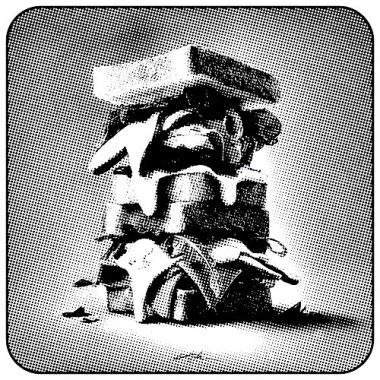Ausgabe #302 | 16. Oktober 2025
Über Geld spricht man nicht
„Man muss dieser Tage gar nicht in den Flieger nach Griechenland steigen, um zu sehen, wie Bürger und Regierung gegen einen drohenden Bankrott kämpfen – der Regionalexpress nach Solingen reicht auch.“
So beginnt im Mai 2010 ein Artikel im STERN.
Der Journalist Lenz Jacobsen berichtet darin über den drohenden Bankrott vieler Kommunen – und ihren weitgehend aussichtslosen Kampf dagegen.
Dass unsere Kommunen strukturell unterfinanziert sind, war schon lange vor 2010 ein Problem. Bis heute hat sich daran wenig geändert.
Besonders problematisch war und ist das für Kommunen, die stark von Deindustrialisierung betroffen sind. Solingen war einst als „Klingenstadt“ bekannt und Weltspitze in der Produktion von Messern. 2010 war davon nur noch ein Schatten übrig. Fast eine Milliarde Euro Schulden hatte die Stadt angehäuft. Es musste also gespart werden. Und das drastisch.
Die Verwaltung erarbeitete eine lange Liste mit Vorschlägen: Schulschließungen, Stadionverkauf, Kürzungen bei Sport und Kultur, Schließung beider Festhallen – die Maßnahmen klangen brutal.
Es lag nahe, sie möglichst schnell und geräuschlos im Stadtrat durchzuwinken. Denn wenn die Menschen sich erst empören, ist Ärger vorprogrammiert. In Solingen entschieden sie sich 2010 für einen anderen Weg:
Sie machten das Sparen zum Thema.
Gewählt wurde das Format eines Bürgerhaushalts, damals gerade im Trend. Nur funktionieren Bürgerhaushalte gemeinhin so, dass die Menschen einer Stadt Vorschläge für Maßnahmen machten und auch darüber abstimmen können. Es geht also um Ausgaben.
In Solingen drehten sie den Spieß einfach um. Aus „Bürgerhaushalt“ wurde „Sparhaushalt“.
Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, 108 Vorschläge zur Haushaltssicherung zu kommentieren und eigene Bürgervorschläge zu machen.
Über www.solingen-spart.de gelangten die Menschen auf eine Online-Plattform, auf der die Haushaltssituation verständlich dargestellt wurde. Mit einer Pro- oder Contra-Stimme konnten die vorgelegten Sparvorschläge sowie Vorschläge zur Erhöhung von Einnahmen bewertet und kommentiert werden.
Heute sind viele Kommunen schon zufrieden, wenn 1 % der Bürgeri*nnen sich an klassischen Bürgerhaushalten beteiligen. In Solingen ging die Beteiligung durch die Decke. Auch, weil sich bundesweit Medien damit beschäftigten – und das längst nicht immer nur positiv.
Hauptkritik war, dass die Verantwortung damit auf die Bürger*innen abgeschoben werden solle – und dass die Verwaltung genau dann die Beteiligung entdecken würde, wenn es nicht um Gestaltung, sondern um das Gegenteil ginge.
Konflikt ist erfahrungsgemäß oft ein Katalysator für Beteiligung. So auch hier.
Am Ende der dreiwöchigen Online-Phase konnten eindrucksvolle Beteiligungszahlen registriert werden: 3.566 Besucher*innen, 4.976 Kommentare und 152.347 Bewertungen durch PRO- oder CONTRA-Stimmen. Von den 108 Vorschlägen wurden von jedem Teilnehmenden durchschnittlich ca. 42 Vorschläge bewertet.
Solingen handelte sich für den Sparhaushalt eine Menge Kritik ein. Gleichzeitig war das aber auch der Beginn einer umfangreichen Beteiligungskultur der Stadt. Den Sparhaushalt gibt es nicht mehr. Doch Beteiligungsleitlinien, ein Beirat, zahlreiche Angebote und sogar vor kurzem der nationale Preis „Gute Bürgerbeteiligung“ für ein Jugendbeteiligungsprojekt folgten.
Der Solinger Sparhaushalt war eine untypische Maßnahme. Andere Kommunen denken bei knappen Kassen eher darüber nach, Formate der Bürgerbeteiligung zu streichen, oft trifft es als erstes genau den Bürgerhaushalt. Doch genau das ist gefährlich.
Über Geld muss man sprechen. Ganz besonders über öffentliches Geld. Und ganz besonders dann, wenn es knapp wird. Was unser Staat für seine Bürger*innen tut, geht alle an. Dazu gehört auch das, was er nicht tut. Oder nicht mehr tun kann.
Über positive Themen zu sprechen, fällt leichter, liegt näher, ist tendenziell konfliktärmer (doch bei weitem nicht immer). Über negative Themen und Entwicklungen zu sprechen ist schmerzhafter, konfliktträchtiger, unangenehmer – und wichtiger.
In Solingen haben sie es getan. Und langfristig eine Beteiligungskultur entwickelt. Um so leichter ist es dort, wo bereits Beteiligungserfahrung vorliegt. Gerade angesichts aktueller wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen kann es nur eine Empfehlung geben:
In Zeiten knapper Kassen sollten wir nicht über weniger Beteiligung nachdenken. Sondern über mehr Beteiligung. Und das heißt eben auch: Wir müssen über Geld sprechen.
Ganz besonders dann, wenn es knapp wird.