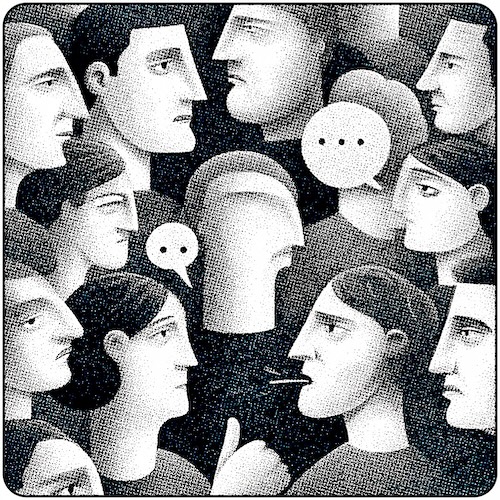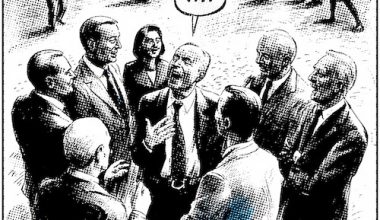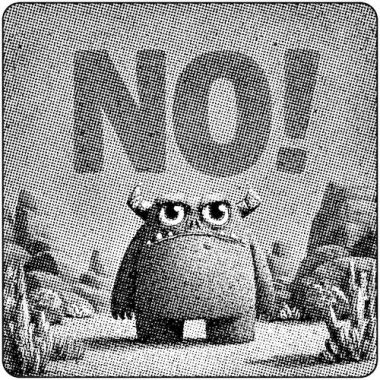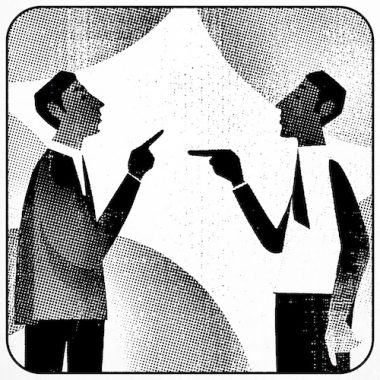Ausgabe #305 | 6. November 2025
Permanente Partizipation
Er war Journalist, Geheimdienstler, Außenminister, Ernährungsminister, Verkehrs- und Verteidigungsminister – und das alles, ohne je ein Studium abgeschlossen zu haben.
Und doch hat Lew Dawidowitsch Bronstein nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch theoretisch gewirkt – bis heute gibt es politische Parteien, die sich auf ihn berufen.
Geboren als Sohn einer kleinbürgerlich-jüdischen Familie in der heutigen Ukraine, hatte er entscheidenden Anteil an der russischen Oktoberrevolution, damals bekannt unter seinem Pseudonym Trotzki – Der Name eines seiner Gefängniswärter in der sibirischen Verbannung.
Er warnte frühzeitig vor der Gefahr eines autoritären Sozialismus. Wenig überraschend geriet er später mit Stalin aneinander, musste fliehen und wurde schließlich 1940 in Mexiko von einem sowjetischen Agenten mit einem Eispickel ermordet.
Politisch war Trotzki zu diesem Zeitpunkt weitgehend einflusslos.
Der Mann, der schon rund 15 Jahre vor der Oktoberrevolution von deren möglichen Folgen warnte, sie dann aber aktiv mitgestaltete, hatte in den Jahren des Exils allerdings viel nachgedacht und geschrieben.
Er hielt die Befreiung der im Zarismus unterdrückten Arbeiter und Bauern nach wie vor für mehr als gerechtfertigt. Der Fehler war aus seiner Sicht ein anderer: Eine zu früh als erfolgreich und beendet erklärte Revolution.
Für Trotzki war eine Revolution kein Projekt – und auch keine Abfolge von Projekten – sondern ein Prozess ununterbrochener sozioökonomischer Transformationen, der erst mit dem endgültigen Sieg der neuen Gesellschaftsordnung auf globaler Ebene abgeschlossen sei.
Diesen Prozess zu unterbrechen, in „Etappen“ zu denken, zeitweise bremsen zu wollen – würde unweigerlich zu Rückschritten führen, am Ende zum Scheitern.
Bis heute wird darüber gestritten, ob und in welchem Umfang Trotzkis Theorie der „Permanenten Revolution“ den Stalinismus erklären kann.
Seine Einschätzung, dass gesellschaftlicher Wandel ein Prozess ist und kein Projekt, wurde jedoch immer wieder bestätigt.
Wir wissen heute: Transformationsprozesse können scheitern, sind reversibel, wenn sie an Dynamik verlieren.
Aktuell sehen wir, dass selbst vermeintlich stabile demokratische Gesellschaften eine Rückentwicklung in autoritäre Strukturen erleben können, die wir längst überwunden glauben.
Man muss kein Trotzkist sein, um zu erkennen, dass Demokratie nicht stabil ist, wenn nicht permanent an ihr gearbeitet wird.
Topaktuell ist das Thema gerade, was die Stärkung unserer konkreten Demokratie durch dialogische Beteiligung angeht.
Wir haben erkannt, dass wir sie brauchen. Weil repräsentative Strukturen an Akzeptanzverlust leiden. Deshalb beteiligen wir, setzen auf Dialoge mit Wirkungsanspruch.
Das allerdings bislang nahezu ausschließlich in Projekten gedacht.
Beteiligungsangebote in Deutschland haben immer einen Anfang, meist ein zügiges Ende, im besten Fall noch eine Wirkung auf politische Entscheidungen – deutlich nach dem Ende des Projektes, wenn die Beteiligten längst wieder hinauskomplimentiert wurden.
Dialogische Beteiligung als Abfolge von Projekten (meist nicht einmal das) kann bestenfalls ein Anfang sein.
Ob sie sich dauerhaft etablieren kann, bleibt offen. Aktuell erleben wir den möglichen Beginn einer Phase des Rückschrittes. Nahezu täglich gibt es aus Kommunen die Meldung, dass Beteiligungsangebote heruntergefahren werden, Mittel werden gestrichen, Stellen in der Verwaltung umgewidmet oder nicht mehr besetzt.
Der Grund ist die systemische Unterfinanzierung unserer Kommunen. Das Geld ist knapp. Es muss gespart und gestrichen werden.
Und da trifft es eben zuerst freiwillige Projekte. Dazu gehört nun mal auch die dialogische Beteiligung.
Die ist anfällig, eben weil wir sie nicht als permanente Aufgabe sehen, sondern als elementaren Bestandteil unserer demokratischen Kultur.
Vor diesem Hintergrund hat der Fachverband Bürgerbeteiligung bei seiner kürzlichen Mitgliederversammlung eine klare Stellungnahme beschlossen.
Er fordert, die dialogische Beteiligung zur kommunalen Pflichtaufgabe zu machen – und die Finanzierung unserer Kommunen entsprechend zu gestalten.
Die Idee dahinter ist genau jene: Partizipation braucht ein Minimum an Permanenz, sonst kommt sie in Krisenzeiten schnell unter die Räder.
Nun wissen wir, dass kommunale Pflichtaufgaben eben jene der sogenannten „kommunalen Daseinsvorsorge“ sind.
Dazu gehören alle Aufgaben und Leistungen, um eine Grundversorgung ihrer Einwohner zu gewährleisten: zum Beispiel Wasser- und Energieversorgung, Abwasser- und Müllentsorgung sowie der Öffentliche Personennahverkehr, aber auch soziale und kulturelle Leistungen wie Bildungseinrichtungen und Krankenhäuser.
Die Stärkung der Demokratie durch dialogische Beteiligung gehört bislang nicht dazu.
Das muss sich ändern.
Von permanenter Partizipation sind wir noch weit entfernt. Doch wenn wir Beteiligung weiter nur als lose Abfolge optionaler Projekte denken, kann das, was in vielen Jahren aufgebaut wurde, schneller verschwinden, als wir uns vorstellen wollen.
Und das gilt auch für unsere Demokratie.
Es wird höchste Zeit, klar zu dokumentieren, dass Demokratie Daseinsvorsorge ist.
Wenn das funktionieren soll, muss Beteiligung so selbstverständlich werden wie Krankenhäuser, Schulen, Zebrastreifen und Abwasserkanäle.
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber einer, auf dem wir nicht anhalten, abbiegen oder umkehren dürfen.
Das hat uns die Geschichte gelehrt.