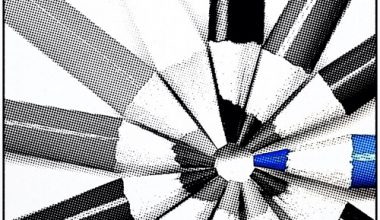Ausgabe #57 | 4. Februar 2021
Die Machtfrage
Mit der Macht ist das so eine Sache. Generationen von Sozialwissenschaftler*innen haben sich daran abgearbeitet. In der Politik scheint es häufig nur darum zu gehen. Und doch gibt es keine einzige, allgemein akzeptierte Definition.
Dabei sind Macht, ihre Institutionen, Strukturen und Prozesse für die Funktionsfähigkeit einer Demokratie ganz entscheidende Themen.
Um so spannender ist es, dass wir uns mit völlig unterschiedlichen Machtkonzepten herumschlagen müssen.
Obgleich das nicht ganz untypisch für demokratisch verfasste Gesellschaften ist: Alle ihre Grundlagen und Konzepte sind bis zu einem gewissen Grad Verhandlungssache.
Das unterscheidet sie von autoritären Gesellschaftskonzepten, das macht sie resilient, aber eben auch anfällig für Missverständnisse.
Ein solches Missverständnis ist die Frage der Macht, insbesondere deren Teilung.
Wir müssen keine glühenden Verehrer*innen von Max Weber sein, dessen Schlüsselwerk zu Macht und Herrschaft auch über ein Jahrhundert nach seinem Tod noch vielen als Denk- und Argumentationsgrundlage gilt.
Es ist bezeichnend, dass diese Theorie von einem Juristen entwickelt wurde – zur Zeit des deutschen Kaiserreiches, vor den großen Revolutionen, den ersten Demokratieversuchen in der Weimarer Republik, vor den dunklen Jahren des Faschismus, des „Realsozialismus“, der modernen demokratischen Staatenwelt.
Das macht Webers Sichtweise nicht weniger wertvoll, aber sicher weniger absolut.
Wenn wir eines in den vergangenen 100 Jahren über Macht gelernt haben, dann dass sie nahezu unendlich viele Ausprägungen und Formen in der Realität annehmen kann, aber doch stets die zentrale Frage moderner Politik geblieben ist. Und das ist möglicherweise ein Teil des Problems.
Letztlich geht es bei Macht immer um die Möglichkeit, andere Menschen dazu zu bewegen, das zu tun oder zu lassen, was man von ihnen möchte – unabhängig von der Methode, den Folgen oder der Legitimität. Genau über diese Kontexte lässt sich in epischem Ausmaß philosophieren.
Doch das würde heute zu weit führen. Schließlich beschäftigen wir uns in unserem Newsletter mit den eher praktischen Themen der Demokratie.
Deshalb halten wir vorerst nur eines fest: Macht zielt auf Unterordnung. Und spätestens da entstehen in einer Demokratie Reibungsflächen und Missverständnisse.
Ganz besonders in der Frage der politischen Teilhabe jenseits von Wahlen. Immer wieder erleben wir insbesondere in der Vorbereitung von Prozessen der Bürgerbeteiligung, dass einzelne Akteure in Politik, aber auch in Verwaltungen, Sorge vor „Machtverlust“ haben. Das bremst Beteiligung oft aus oder führt dann zu sehr seltsamen, starren, wenig ergebnisoffenen Formaten. Das ist bedauerlich, denn tatsächlich beruht diese Sorge auf einem Irrtum.
Ebenso wie die Erwartung mancher Beteiligter. Die eine oder andere Einladung oder Eröffnungsrede weckt diese Erwartung bewusst oder unbewusst: Bürgerschaftliches Engagement in Beteiligungsprozessen, die Investition von Zeit, Geduld, auch Frustrationsbereitschaft und Willen zur Konfliktüberwindung wird belohnt mit Teilhabe an der Macht.
Wird sie nicht.
Wir erinnern uns: Macht ist immer auf andere Menschen bezogen. Macht braucht – mehr oder weniger freiwillige, oft erzwungene – Unterordnung. Macht ist ein beständiger gesellschaftlicher Konfliktstoff. Eines aber ist sie nicht: Verhandlungssache in Beteiligungsprozessen. Die Frage der Macht wird in einer Demokratie in Wahlen geklärt.
In der Beteiligung geht es nicht um Macht – es geht um Wirkung.
Ob in kleinen, kommunalen Fragen oder in größeren Prozessen von umfangreicher Bedeutung für viele Bürger*innen: Ihre Wirksamkeit – und die persönliche Erfahrung derselben – ist Anliegen und Verhandlungssache zugleich. Hergestellt wird sie über dialogische Prozesse, über Deliberation, aber eben nicht über Macht.
Sich dessen bewusst zu sein, kann viel Entspannung in Beteiligungsfragen bringen:
Zu wissen, die qua Wahl oder Amt verliehene Macht der Beteiligenden steht nicht zur Disposition, kann mehr, intensivere, ergebnisoffene Beteiligung ermöglichen.
Zu wissen, es geht um die Wirksamkeit der Beteiligungsergebnisse, die ganz erheblich von deren inhaltlicher Qualität und Entstehungsprozedur abhängt, kann Beteiligten helfen, sich stärker auf eben diese Fragen einzulassen.
Umgekehrt können wir immer dann, wenn in Beteiligungsprozessen Koalitionen geschmiedet und Abstimmungen gefordert werden, mit großer Sicherheit vermuten, dass die hier beschriebene notwendige klare Trennung von Macht und Wirksamkeit nicht allen am Prozess Beteiligten bewusst ist.
Je stärker sich ein Beteiligungsprozess an Machtfragen abarbeitet, desto mehr riskiert er seine Wirksamkeit. Und wir sollten nie vergessen:
Wirkungslose Beteiligung ist letztlich wertlose Beteiligung.