Ausgabe #77 | 24. Juni 2021
Wir Egoisten
2013 hatte die SPD im Bundestagswahlkampf einen genialen Slogan. „Das WIR entscheidet“. Er sollte das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen, das Miteinander, die Solidarität. Passte gut zu einer sozialdemokratischen Partei.
So gut, dass die Recherche dazu im Kampagnenteam etwas nachlässig ausfiel. Hätte nur ein Praktikant mal bis Seite 2 gegoogelt, hätte die SPD das Desaster abwenden können: Der Slogan war alt.
Die Presse bekam rasch raus, dass eine Zeitarbeitsfirma schon 6 Jahre zuvor mit dem selben Motto geworben hatte. So stand die SPD über Nacht als Truppe plagiierender Trottel da und musste eine ganze Kampagne umbauen.
Das Lustige daran: Auch die Presse recherchierte schlampig. Tatsächlich stammte der Slogan schon aus den 50er Jahren. Von der CDU. Der CDU in der DDR. Nicht auszudenken, wenn auch das noch aufgepoppt wäre.
Vor allem aber: Der Slogan war eigentlich falsch. Viel zutreffender gerade für eine freiheitliche Demokratie wäre eigentlich:
„Das Ich entscheidet“.
Denn eine starke Demokratie braucht vor allem einen klugen Umgang mit dem ICH. Tatsächlich entscheidet sich der Grad an Gemeinwohl, den eine Gesellschaft generieren kann nicht durch Apelle ans WIR, sondern in der Frage, wie viel ICH sie zulassen kann.
Und da sind wir bei zwei entscheidenden Begriffen, die damit zusammenhängen. Beide tauchen aus gutem Grund in Debatten um den Zustand unserer Demokratie immer wieder auf: Gemeinwohl und Selbstwirksamkeit. Jeder für sich ist komplex, in einigen älteren Ausgaben dieses Newsletters haben wir sie beleuchtet.
Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir stellen uns die Frage, was Gemeinwohl und Selbstwirksamkeit miteinander zu tun haben. Bedingt das eine das andere? Oder das andere das eine? Befeuern sie sich gegenseitig? Oder muss man sich zwischen den beiden entscheiden?
Die kurze Antwort auf diese vier Fragen lautet:
Ja.
Die Lage ist etwas komplizierter. Und sie beschäftigt Verhaltensforscher*innen, Soziolog*innen und Philosoph*innen seit Generationen.
Die Fähigkeit, durch Verzicht auf eigenen Vorteil Gemeinwohl zu befördern, haben nicht nur Menschen. Allerdings macht längst nicht jede*r von dieser Fähigkeit Gebrauch. Wir Menschen können offensichtlich Altruist*innen sein, handeln aber vorzugsweise doch egoistisch.
Steckt dahinter immer freier Wille?
Grundsätzlich geht das Menschenbild unserer freiheitlichen Demokratie eher nicht von altruistischem Handeln aus. Wozu sonst bräuchten wir Unmengen von Gesetzen, Gerichten, Gefängnissen?
Unser Rechtssystem behandelt die Menschen als wären sie Egoisten.
Und im Prinzip hat sich dieser Ansatz ebenso bestätigt wie bewährt. Würden wir glauben, dass Menschen durch Erkenntnis zu gemeinwohlorientiertem Handeln bewegt werden könnten, hätten wir in der Pandemie nicht alle paar Tage neue, immer komplexere „Corona-Verordnungen“ erlassen müssen. Ein Tagesschau-Interview mit dem Virologen Drosten und ein ernsthafter Apell zum Maskentragen hätten genügt.
Wir sind eine Gesellschaft von Egoist*innen. Darauf basiert unser Rechtssystem, unser Sozialsystem, unser politisches System. So werden wir in den Schulen erzogen, in der Werbung angesprochen und in der Arbeitswelt konditioniert.
Spannend wird es, wenn wir dann plötzlich über neue Formen demokratischen Handelns nachdenken: In Planungszellen, Bürgerräten und vielen anderen Formaten soll nun plötzlich Gemeinwohl generiert werden.
Die Zutaten sind, wenn es gut gemacht ist, Information, Diskussion, gute Moderation. Und doch funktioniert es oft genug nicht oder nur sehr eingeschränkt.
Aber wie sollte es auch?
Wir sind konditioniert, uns als Egoist*innen zu verhalten, andere als Egoist*innen zu betrachten und all das zu tun, was erlaubt ist, um uns Vorteile zu schaffen.
Altruismus können wir nicht. Weil wir ihn nicht lernen dürfen. Weil er uns in unserer Gesellschaft auch keine Vorteile verschafft.
Dieses Problem ist eine der größten Herausforderungen in nahezu allen Prozessen der Bürgerbeteiligung. Genau deshalb ist in jüngster Vergangenheit die Nutzung von so genannten „Zufallsauswahlen“ so beliebt geworden.
Der Gedanke ist bestechend: Sobald die Egoist*innen in der Beteiligung nicht mehr selbst betroffen sind, sind gemeinwohlorientierte Lösungen möglich. Weil das so lokalisiere Gemeinwohl nicht mehr mit den eigenen Partikularinteressen konkurriert.
In der Praxis funktioniert das gut.
So gut, dass in letzter Zeit sogar schon der ein oder andere ernsthafte lokale Konflikt mit zufallsbasierten Bürgerräten abgeräumt werden sollte.
Doch das ist eine ebenso verlockende wie gefährliche Sackgasse.
Denn wer in einem Konflikt nicht die Betroffenen beteiligt, sondern Nichtbetroffene, bekommt möglicherweise schmerzfreie Lösungen – aber am Ende draußen in der wirklichen, betroffenen Welt, keinen Millimeter Akzeptanz dafür.
Aktuell sucht ganz Deutschland nach einem möglichst sicheren Standort für ein atomares Endlager. Auch das könnte man einfach haben: Ein paar wissenschaftliche Gutachten, dann einen 20-köpfigen Bürgerrat und der Standort wäre fixiert. Vermutlich nicht in unmittelbarer Nähe eines der Mitwirkenden, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar an einem wissenschaftsbasiert „vernünftigen“ Standort.
Niemand würde dieses Verfahren jedoch ernsthaft erwägen, denn ein so gewählter Standort hätte keine Aussicht auf Akzeptanz der Menschen vor Ort.
Langfristig bleibt also – für jede Art von Konflikt – die große Herausforderung, in einem offenen Beteiligungsprozess unmittelbar Betroffene „Egoist*innen“ zu gemeinsamen, gemeinwohlorientieren Lösungen zu befähigen.
Und genau hier kommt die Selbstwirksamkeit ins Spiel.
Wer am eigenen Leib erfahren hat – und das immer wieder –, dass persönliches Handeln, Mitwirken, Mitstreiten, Mitarbeiten sich unmittelbar in Wirkung niederschlägt, der ist sich seiner Selbstwirksamkeit bewusst.
Das macht stark. Und es macht resilient. Denn Selbstwirksamkeit ist ein Werkzeug, das fein justiert eingesetzt werden kann. Ein Werkzeug, das wir benötigen, um aus individueller Wirksamkeit gemeinschaftliche Wirksamkeit zu generieren.
So, und nur so, können Gruppen aus Partikularinteressen Gemeinwohllösungen „bauen“. Indem jede und jeder über Werkzeuge verfügt, die er oder sie aufgrund von Erfahrung einsetzen kann. Kann er oder sie das nicht, geht es nur um den totalen Sieg oder die vollständige Niederlage.
Wie allein das Selbstwirksamkeitsbewusstsein eine Gesellschaft zusammenhalten kann, zeigt uns die Schweiz. Obwohl dort oft heftige politische Konflikte ausgetragen und knapp in Volksabstimmungen entschieden werden, bleiben die Schweizerinnen und Schweizer erstaunlich gelassen. Denn genau diese starke direktdemokratische Tradition gibt ihnen die nötige Souveränität.
Die Schweizer*innen wissen einfach, dass sie politische Entscheidungen der Regierenden potenziell korrigieren können. Sie praktizieren es immer wieder.
Wie aber sieht es in Deutschland mit den Selbstwirksamkeitserfahrungen aus? In der Schule? Der Ausbildung? Am Arbeitsplatz? Im politischen Alltag? Meistens: Fehlanzeige.
Wir trainieren und lehren die falschen Dinge. Wir leben als Gesellschaft von Egoist*innen und merken, dass es so nicht mehr wirklich funktioniert. Wir suchen den Diskurs in tausend Beteiligungsformaten vom Spielplatzbau bis zur Endlagersuche. Und wir leiden in diesen Formaten, weil es so schwierig ist, von unseren trainierten Sicht- und Verhaltensweisen abzulassen. Es gibt so viele Beteiligungspraktiker*innen, die das dennoch immer wieder irgendwie hinbekommen.
Aber wir würden ihnen und uns allen das Leben sehr viel leichter machen, wenn wir allen, und ganz besonders den jungen Menschen reichhaltige Möglichkeiten offerieren, solche Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen.
Denn wir müssen nicht zu einer Gesellschaft von Altruist*innen werden. Eine Gesellschaft von souveränen, selbstwirksamkeitsbewussten Menschen reicht.Das würde unsere Demokratie auf Generationen hinaus stärken. Wir müssten nur unsere Art zu lehren, zu lernen, zu arbeiten und Konflikte zu klären ändern.
Klingt natürlich einfacher, als es ist. Aber anfangen könnten wir durchaus damit. Positive Beispiele gibt es genug. Nicht nur in den so genannten „demokratischen Schulen“ (die wir uns in Kürze genauer anschauen), sondern auch in immer mehr Unternehmen wird experimentiert, geübt, verworfen und neu erfunden. Das ist gut so, denn es gilt:
Jede Selbstwirksamkeitserfahrung erhöht die Chancen auf Gemeinwohl.
Genau das ist der Zusammenhang, den wir heute beleuchten wollten.
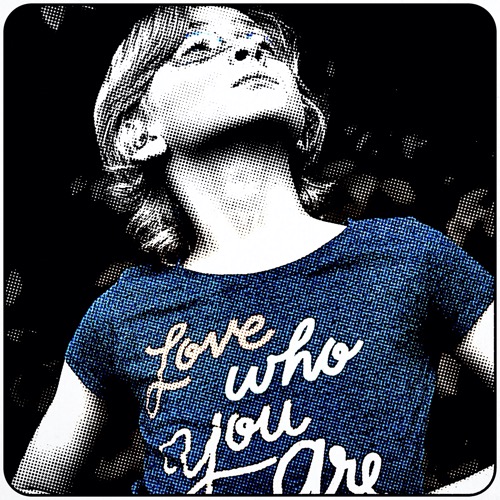








Ihre Themen und Perspektiven finde ich eigentlich immer interessant und Ihren Newsletter lesenswert. Allein die Freude wird getrübt: Die sogenannte „gendergerechte Sprache“, die leider auch Sie verwenden erschwert das Lesen und ist zudem grammatikalisch falsch. Außerdem trägt sie in keiner Weise zu mehr Geschlechtergerechtigkeit bei, sondern diskriminiert all jene, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Also lassen Sie doch den Unsinn!
Liebe Sabine Klages-Buechner,
vielen Dank für Ihr Lob und: Ich bedaure sehr, dass meine Entscheidung so zu gendern, wie ich es tue, Ihre Lesefreude trübt. Die Debatte wird ja zur Zeit in Deutschland mit teils heftigster Empörung auf allen Seiten geführt. Auch bei Ihnen scheint es einen Nerv getroffen zu haben. Da ich immer wieder mal diesbezüglich kritisiert werden (Auch von Menschen, denen ich nicht konsequent genug gendere) schildere ich hier gerne noch einmal kompakt meine Position: Gendern alleine löst die Geschlechterfrage nicht. Es stört beim Lesen. Das soll es auch. Weil es zum Nachdenken anregt. Wer diese Anregung nicht möchte, kann sich ihr in einer freien Gesellschaft ganz einfach entziehen: Sie oder Er oder Es liest diese Texte einfach nicht.
Herzlichst, Jörg Sommer
Auch wenn ich Ihre Analyse im ersten Teil des Beitrags uneingeschränkt teile, war beim Weiterlesen irritiert, dass Sie Selbstwirksamkeitserfahrung als Grundlage für mehr Gemeinwohlengagement darstellen.
In der Praxis erlebe ich eher, dass eine Bürgerinitiative nachdem sie erfolgreich ein Projekt verhindert hat, in dem z.B. nach Gas gebohrt werden sollte, aus dieser Erfahrung heraus sich mutig in den nächsten Kampf stürzt, wenn ein Jahr später an gleicher Stelle z.B. Windräder gebaut werden sollen.
Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist aus meiner Sicht eher etwas, das zu mehr Engagement führt. Ob dieses Engagement dann aber für mehr Ich-Wohl oder mehr Gemeinwohl eingesetzt wird, hängt von den jeweiligen Interessen der Agierenden ab.
Lieber Rene Zimmer,
ja, das klingt zunächst einmal widersprüchlich und irritiert. Aber tatsächlich führen erst umfangreiche und wiederholte Selbstwirksamkeitserfahrungen dazu, dass die Kompetenz entsteht, in Konflikten so zu interagieren, dass Gemeinwohlpotential entsteht.
Nehmen wir Ihr sehr gutes Beispiel einmal und betrachten es von der anderen Seite her. Das würde ja bedeuten, wir sollten als Gesellschaft solche Selbstwirksamkeitserlebnisse unterbinden oder vermeiden, weil sie zu mehr Konflikten führten. Das führen sie oft. Aber das ist nichts, vor dem wir uns fürchten sollten.
Tatsächlich sind die Zusammenhänge aber zu komplex, um sie so einfach kausal zu verknüpfen. Vielleicht hilft es uns weiter, wenn wir Selbstwirksamkeitserfahrung nicht mit Sieg in einem Konflikt gleichsetzen. Auch wenn ein „Sieg“ eine solche Erfahrung produzieren kann, so bedarf nicht jede solche Erfahrung eine Sieges.
Herzlichst, Jörg Sommer
super-interessant, aber ein paar Worte dazu, was diese Selbstwirksamkeit ist, könnten hilfreich sein. Der Begriff wird, meine ich, allzu en passant eingeführt und dann auf seine Vorteile hin (zwischen Altruismus und Egoismus) diskutiert. Wenn mich jetzt jemand frägt, was S. ist, ich könnt es nich klar sagen, sondern müsste etwas hilflos rumdrucksen
Lieber Alfred Pfaller,
ich verstehe. Da in einer einzigen Ausgabe immer nur wenig Platz zur Verfügung steht, habe ich diesmal nur sehr pauschal auf „ältere Ausgaben“ verwiesen. ich hätte da konkreter machen sollen. Konkret wurde das Thema bereits in sechs vergangenen Ausgaben angesprochen. Am ergiebigsten illustriert wurde ist in den beiden Ausgaben
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
Herzlichst, Jörg Sommer